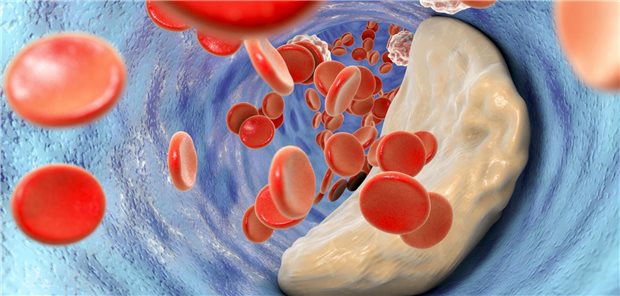Versorgung
Patienten mit Behinderungen müssen sich gedulden
Behandlungszentren für Patienten mit Behinderungen sollen die Versorgung verbessern. Doch die Selbstverwaltung lahmt.
Veröffentlicht:BERLIN. Ansätze für eine bessere Versorgung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen bleiben in den Mühlen der Selbstverwaltung hängen.
Die Koalition hat 2015 im Versorgungsstärkungsgesetz (VSG) die Grundlage für Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen geschaffen (MZEB).
Zuvor sind diese Patienten, nachdem sie als Kinder und Jugendliche in Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) behandelt wurden, in die Regelversorgung verwiesen worden. Dort aber fehlt es für sie oft an interdisziplinären und multiprofessionellen Versorgungsangeboten.
Die Grünen im Bundestag haben sich nach dem Umsetzungsstand der neuen Regelung in Paragraf 119c SGB V erkundigt – und sind alles andere als zufrieden. Die MZEB liefen Gefahr „Opfer einer trägen Selbstverwaltung zu werden“, sagt Maria Klein-Schmeink, gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.
Vier Länder sind Terra incognita
Nach der Antwort der Bundesregierung, die der „Ärzte Zeitung“ vorliegt, sind in den Jahren 2017 und 2018 bundesweit 26 Anträge zur Ermächtigung von MZEB gestellt worden. Nur 13 Anträge wurden bisher positiv beschieden. In Bayern und Thüringen sind es jeweils drei Einrichtungen, in sechs weiteren KV-Regionen wurde je ein MZEB etabliert.
In Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland und Schleswig-Holstein ist in der Zweijahres-Frist nichts Greifbares passiert. Neun Anträge kreisen noch in der Selbstverwaltung, einige davon befinden sich im Widerspruchsverfahren.
Nimmt man den gesamten Zeitraum seit Inkrafttreten des VSG am 23. Juli 2015, sieht es nur wenig besser aus. 38 Zentren gibt es demnach inzwischen bundesweit. Nordrhein (8), Bayern (7), Niedersachsen (6), Rheinland-Pfalz (4) sowie Baden-Württemberg und Thüringen (je 3) und Westfalen-Lippe (2) können mehrere Zentren vorweisen.
In fünf weiteren KV-Regionen ist bisher nur ein MZEB etabliert, vier Länder sind noch Terra incognita für MZEB.
Zeitspiel unterstellt
Für Klein-Schmeink spielen viele Kassen auf Zeit. Bis zum Abschluss einer Leistungs- und Vergütungsvereinbarung als Grundlage eines MZEB vergingen bis zu drei Jahre, kritisiert sie. „Die Verhandlungsstrategie ist oftmals auf Zeitgewinn und Kostenersparnis ausgerichtet.“
Nach ihrem Eindruck soll der Leistungsumfang der Einrichtungen so weit wie möglich eingeschränkt werden, um Geld zu sparen. Die Grünen-Politikerin sieht darin schweres Versäumnis. MZEB seien „ein höchst innovatives Modell, das es schaffen könnte, eine seit langem beklagte Versorgungslücke zu schließen“.
Der Gesetzgeber habe im Versorgungsstärkungsgesetz einen „offenen Ansatz“ gewählt, der den Beteiligten in der Region „viel Freiheit“ gebe, angepasste Lösungen vor Ort zu entwickeln, erläutert die Regierung.
Intervenieren will sie im Umsetzungsprozess nicht und habe dazu auch keine Kompetenzen. Die Umsetzung des Paragrafen 119c „obliegt der Selbstverwaltung. (fst)