DiGA
Viel Geld für wenig Evidenz? TK-Chef erneuert Kritik an Apps auf Rezept
Man muss mit der Zeit gehen, dachte sich wohl der Gesetzgeber, als er 2019 mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz auch Gesundheitsapps erstattungsfähig machte. An den Modalitäten reiben sich die Kassen nach wie vor.
Veröffentlicht: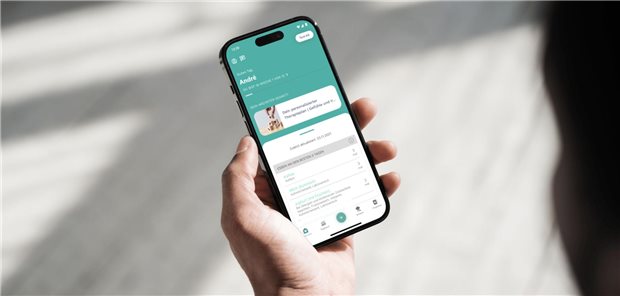
Licht und Schatten: Den Therapieprogrammen im Westentaschenformat können die Kostenträger nicht nur gute Seiten abgewinnen.
© (c) Mahana Therapeutics™
Hamburg. Ende September 2020 wurde die erste Digitale Gesundheitsanwendung in das DiGA-Verzeichnis der Bonner Oberbehörde BfArM aufgenommen. Grund genug für die Techniker Krankenkasse, eine erste Bilanz zu ziehen.
Und die fällt erwartungsgemäß – weil so oder so ähnlich schon öfter gehört – durchwachsen aus: „Sinnvoll eingesetzt können DiGA zu einer besseren und innovativeren Versorgung beitragen“, so TK-Vorstandsvorsitzender Dr. Jens Baas am Donnerstag.
Allerdings brauche es eine Reform der Preisbildung und bessere Nutzennachweise. Anbieter könnten ihre Produkte bis zur finalen Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis ein Jahr lang unter völlig freier Preisbildung zulasten der gesetzlichen Kostenträger vermarkten. In diesen 12 Monaten beträgt laut TK der durchschnittliche DiGA-Herstellerpreis 540 Euro.
Digitale Gesundheitsanwendung auf Rezept
Die aktuellen Diabetes- und Adipositas-DiGA im Überblick
Dagegen sei die mittlere ausgehandelte Vergütung nach Nutzennachweis dauerhaft in das DiGA-Verzeichnis aufgenommener Apps mit 229 Euro nicht einmal halb so hoch. Dabei lasse sich längst nicht für jede DiGA am Ende auch ein Nutzen unter Beweis stellen.
„„Rückwirkend ab dem ersten Tag!“
Baas: „Die Solidargemeinschaft trägt trotz häufig nicht nachgewiesenem Nutzen die Last für hohe Herstellerkosten, lange Erprobungsphasen und für Ausfallrisiken, wenn Hersteller aus dem Verzeichnis gestrichen werden oder Insolvenz anmelden.“
Der Kassenchef plädiert deshalb dafür, DiGA-Preise auch in der Zeit von der vorläufigen Verzeichnisaufnahme – und damit dem Erstattungsbeginn – bis zur endgültigen Preisfindung nach Verhandlung wirksamer zu regulieren.
Hauptstadtkongress 2025
DiGA-Experten fordern breiteres Angebot
Zudem solle die Erprobungsphase verkürzt werden und der ausgehandelte Erstattungsbetrag „rückwirkend ab dem ersten Tag der Aufnahme in das DiGA-Verzeichnis gelten“. In fünf Jahren „Apps auf Rezept“ habe die TK dafür rund 84 Millionen Euro ausgegeben, heißt es. In dieser Zeit seien „mehr als 300.000 Freischaltcodes für DiGA eingelöst worden“.
Laut einem früheren Report des GKV-Spitzenverbands waren von September 2020 bis Jahresende 2024 über eine Million DiGA „ärztlich verordnet oder von den Krankenkassen genehmigt“ worden, die mit GKV-Ausgaben von rund 234 Millionen Euro einhergingen (ohne AOK-Zahlen).
Zehn DiGA-Ziffern im EBM
Aktuell sind 46 Digitale Gesundheitsanwendungen beim BfArM dauerhaft, weitere elf vorläufig gelistet. Der EBM beinhaltet momentan neun Ziffern zur Verlaufskontrolle jeweils spezifischer DiGA (GOP 01471 bis 01479); zum 1. Oktober kommt eine zehnte hinzu (GOP 01481 zur Auswertung der Kardio-App „ProHerz“). Sämtliche Ziffern sind einheitlich mit 64 Punkten (7,93 Euro) dotiert.
Digitalisierung
Elektronische DiGA-Verordnung kommt frühestens 2026
Zum gleichen Betrag können gemäß Anhang 34 des Bundesmantelvertrags vertragsärztliche Leistungen abgerechnet werden (unter Pseudo-Ziffer 86700, einmal im Berhandlungsfall, maximal zweimal im Krankheitsfall), die das BfArM als erforderlich für Anwendungen bestimmt hat, die zunächst nur vorläufig in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen wurden.
DiGA-Verlaufskontrollen durch Vertragsärztinnen und -ärzte kosteten die Krankenkassen im vergangenen Jahr rund 732.000 Euro, wie der GKV-Spitzenverband auf Nachfrage mitteilt. Im 1. Quartal dieses Jahres flossen dafür bereits über 379.000 Euro an EBM-Honorar. Voraussichtlich dürften damit 2025 erstmals und deutlich über eine Million Euro auf diese Leistung entfallen. (cw)









