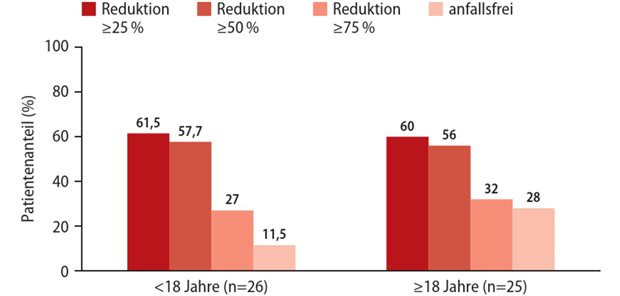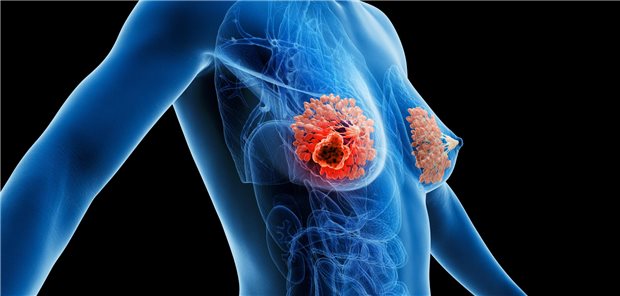Frauengesundheit
Jede achte Frau braucht nach der Geburt Antidepressiva
Etwa elf Prozent aller Frauen leiden im ersten Jahr nach der Geburt an Depressionen. Unter jungen Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren ist der Anteil fast doppelt so hoch.
Veröffentlicht:
Am stärksten depressionsgefährdet sind junge und sozial schwache Mütter und solche mit Depressionen in der Vorgeschichte.
© MachineHeadz / iStock
LONDON. Depressionen nach einer Entbindung sind keine Seltenheit. Bislang ist jedoch wenig darüber bekannt, welche Frauen ein besonders hohes Risiko für den „Entbindungsblues“ tragen, wann eine solche Depression von ärztlicher Seite erkannt wird und was Ärzte dagegen tun, berichten Gesundheitsforscher um Professor Irene Petersen vom University College in London (BMJ Open 2018; 8:e022152).
Aktuelle Daten liefern die Forscher nun anhand einer britischen Untersuchung mit rund 207.000 Frauen, die in den Jahren 2000–2013 Mutter geworden waren. Demzufolge entwickelt rund jede zehnte Frau im ersten Jahr nach der Entbindung eine ausgeprägte Depression, jede achte benötigt Antidepressiva.
Viele junge Mütter betroffen
Das Team um Petersen hat für seine Analyse Angaben einer großen britischen Hausarztdatenbank ausgewertet (The Health Improvement Network). Diese umfasst Daten aus Allgemeinarztpraxen zu rund sechs Prozent der britischen Bevölkerung. In die Datenbank fließen neben Diagnosen und Medikamentenverordnungen auch Symptombeschreibungen mit ein, zudem lässt sich anhand von Adressen und Postleitzahlen ein Deprivationsindex erstellen, der Auskunft über die sozioökonomische Lage der Patienten gibt.
Zumeist kümmern sich in Großbritannien Hausärzte um die Versorgung der Mütter nach der Geburt, diese werden etwa sechs bis acht Wochen nach der Entbindung zu einem Check-up einbestellt.
Bei elf Prozent der Frauen hatten die Ärzte im ersten Jahr nach der Entbindung eine Depression, eine postpartale Depression oder depressive Symptome festgestellt. Zwölf Prozent der Frauen bekamen im ersten Jahr nach der Entbindung Antidepressiva verordnet. Am häufigsten (zu 92 Prozent) verschrieben die Ärzte SSRI, drei Prozent aller Frauen erhielten eine Psychotherapie.
31 Prozent aller Mütter hatten schon vor der Entbindung mindestens einmal einen Vermerk zu Depressionen oder depressiven Symptomen erhalten. Von diesen waren nach der Geburt 15 Prozent mit Depressionen und 24 Prozent mit Antidepressivaverordnungen aufgefallen. Solche Frauen bekamen ihre Depression oft schon in den ersten sechs Wochen nach der Geburt als Mütter, die zuvor keine gravierenden Stimmungstiefs hatten.
Mütter im Alter von 15–19 Jahren litten – unabhängig von ihrem sozialen Status – doppelt so häufig an Depressionen als solche im Alter von 30–34 Jahren; auch bekamen sie doppelt so häufig Antidepressiva. In der untersten sozialen Schicht war die Rate von Depressionen rund 50 Prozent höher als in der obersten Schicht, ebenfalls unabhängig von anderen Faktoren.
Depressionen früh erkannt
Am Anteil der Mütter mit depressiven Beschwerden und Antidepressivabehandlung hat sich insgesamt im Laufe der 13 untersuchten Jahren wenig geändert, allerdings schob sich der Beginn der Therapie mit der Zeit näher an die Entbindung heran: So wurden zum Schluss der Untersuchungsperiode fast doppelt so oft Frauen acht Wochen nach der Geburt antidepressiv therapiert wie zu Beginn des Jahrhunderts.
Dies deutet darauf, dass Hausärzte die Depressionen mittlerweile recht früh erkennen. Insgesamt notierten die Ärzte ein Stimmungstief am häufigsten sechs bis acht Wochen nach der Entbindung – also beim ersten Check-up –, danach flaute die Inzidenz deutlich ab.
Das Fazit der Forscher um Petersen: Am stärksten depressionsgefährdet sind junge und sozial schwache Mütter sowie solche mit Depressionen in der Vorgeschichte, am häufigsten treten die Beschwerden in den ersten beiden Monaten nach der Entbindung auf. Diese Angaben könnten Ärzten helfen, Depressionen nach der Entbindung noch besser aufzuspüren und anzugehen.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: PPD: Mutter-Unglück