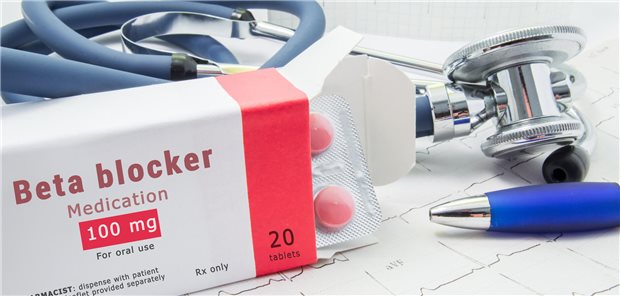Impfung
Tausende HPV-Tumoren pro Jahr sind vermeidbar
Viele Krebserkrankungen in Deutschland ließen sich durch einen Schutz vor HPV vermeiden, so Berechnungen des RKI. Das Institut rät zum Impfen – das könnte auch bei Jungen sinnvoll sein.
Veröffentlicht: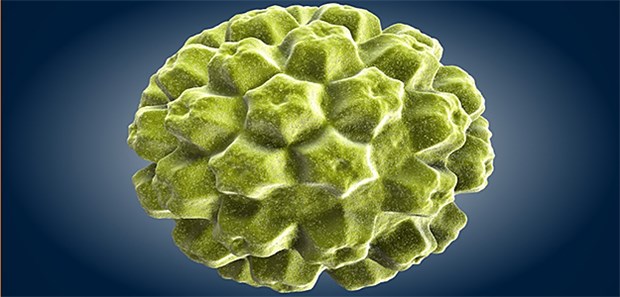
Modell eines HP-Virus: Forscher des RKI vermuten, dass erst nach 2023 die HPV-indizierten Tumoren deutlich zurückgehen.
© Sebastian Schreiter / Springer Medizin Verlag GmbH
BERLIN. In Deutschland wird Mädchen ab dem neunten Lebensjahr bekanntlich eine Impfung gegen humane Papillomaviren (HPV) empfohlen, um Zervixkarzinomen vorzubeugen.
Allerdings lösen HP-Viren nicht nur Tumoren an der Zervix aus, auch Plattenepithelkarzinome im Mund- und Rachenraum, an Vulva, Vagina, Anus und Penis sind zumindest teilweise durch HPV bedingt. Auch hier könnte eine Impfung gegen HPV die Inzidenz solcher Erkrankungen deutlich senken.
Wie viele HPV-bedingte Tumoren genau verhindert werden könnten, hat ein Team um Dr. Nina Buttmann-Schweiger vom Robert Koch-Institut (RKI) anhand des deutschen Krebsregisters berechnet (BMC Cancer 2017; 17: 682). Damit wollen sie einen Grundstein für das Monitoring in der Zukunft legen – so sollten viele der Tumoren zumindest bei Frauen seltener werden, falls flächendeckend geimpft wird.
Das RKI-Team ging davon aus, dass praktisch alle Zervixkarzinome auf einer HPV-Infektion basieren. Für andere Tumoren nahmen sie aus der Literatur Angaben zur Häufigkeit eines HPV-DNA-Nachweises oder anderer HPV-Marker zur Hand.
Viele Erkrankungen durch HPV
Danach lassen sich rund 90 Prozent aller Plattenepithelkarzinome des Anus, 80 Prozent der Vagina, 32 Prozent des Penis‘, 18 Prozent der Vulva und 16 Prozent des Oropharynx auf HPV zurückführen.
Die Forscher um Buttmann-Schweiger schauten nun im deutschen Krebsregister für das Jahr 2013 nach solchen Tumoren. Da die HPV-Impfung erst seit 2007 bei Mädchen empfohlen wird, dürfte sie 2013 noch keine Auswirkungen auf die Krebsinzidenz gehabt haben.
Von den über 482.000 neu diagnostizierten Tumoren im Jahr 2013 waren knapp 16.000 potenziell HPV-verursacht. Wurden die genannten Häufigkeiten von HPV in den jeweiligen Tumoren berücksichtigt, reduzierte sich die Zahl auf knapp 7600 HPV-bedingte Krebserkrankungen. Demnach ließen sich 1,6 Prozent aller Krebsneuerkrankungen im Jahr 2013 auf eine HPV-Infektion zurückführen.
Rund 6240 HPV-bedingte Tumoren traten bei Frauen auf, 1360 bei Männern. Wie erwartet stellten Zervixkarzinome den größten Teil (58 Prozent insgesamt, bei Frauen 71 Prozent). Immerhin 42 Prozent aller HPV-assoziierten Tumoren betrafen aber nicht den Gebärmutterhals – die Schutzwirkung einer Impfung würde also weit über die Zervix-Ca-Prävention hinausreichen.
Mund häufig bei Männern betroffen
Unter Männern waren Tumoren im Mund- und Rachenraum die häufigsten HPV-verursachten Karzinome (47 Prozent), gefolgt von Anus- und Penistumoren (jeweils 36 und 17 Prozent). Auf Platz zwei bei Frauen fanden sich Analkarzinome (15 Prozent), gefolgt von Vulva-, Vaginal- und Oropharyngealtumoren (jeweils 8 Prozent, 4 Prozent, und 3 Prozent).
Fast die Hälfte der Zervixkarzinome wurde bei Frauen unter 50 Jahren beobachtet, bei allen anderen Tumoren lag der Altersschwerpunkt zwischen 50 und 64 Jahren (Anal- und Oropharyngealtumoren) sowie zwischen 65 und 80 Jahren (Vagina-, Vulva- und Peniskarzinome).
Die Forscher um Buttmann-Schweiger rechnen kaum damit, dass die Inzidenz von HPV-Tumoren vor 2023 spürbar zurückgeht – dann sind die ersten geimpften Frauen 35 Jahre alt. Erst im Jahr 2038 zählen alle Frauen unter 50 Jahren zu den Impfkohorten.
Die Studie könne aber die Diskussion über eine HPV-Impfung bei Jungen befeuern, schreiben die Studienautoren – immerhin erkranken jedes Jahr rund 1360 Männer an vermeidbaren HPV-Tumoren.