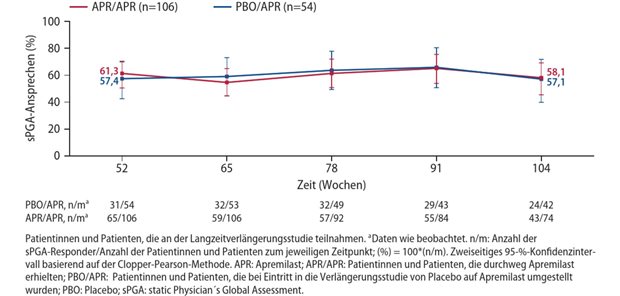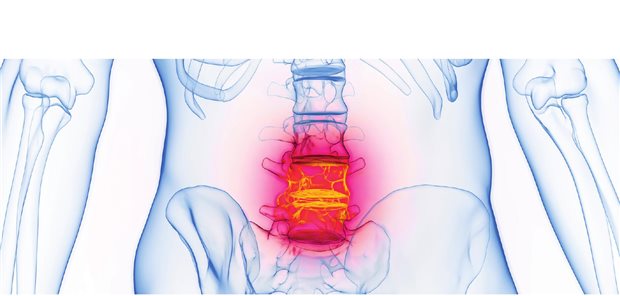ErgoJack
Soft-Orthese animiert zu ergonomischen Bewegungen
Mit ErgoJack haben Fraunhofer-Forscher eine intelligente softrobotische Oberkörperorthese entwickelt, die Arbeitskräfte mit einer Echtzeit-Bewegungserkennung unterstützt und bei Haltungen oder Bewegungen warnt, die gesundheitsschädlich sind.
Veröffentlicht:
ErgoJack mit arretierbarem Hüftgelenk und Beinbügel unterstützt beim Heben schwerer Lasten.
© Armin Okulla
BERLIN. Stundenlang steht der Schweißer gebückt über dem Anlagenbauteil – Rückenschmerzen sind bei dieser Zwangshaltung vorprogrammiert. Üben Mitarbeiter diese Tätigkeit über Jahre hinweg aus, ohne auf eine ergonomische Körperhaltung zu achten, sind dauerhafte Schädigungen wie vorzeitiger Rückenverschleiß keine Seltenheit, erinnert die Fraunhofer-Gesellschaft. Dies gelte auch für Arbeitskräfte, die ständig schwere Gegenstände heben müssen.
Mit ErgoJack haben Wissenschaftler der Berliner Fraunhofer-Institute für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik IPK und für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM nun eine intelligente Softorthese entwickelt, die den Rücken entlastet und Arbeitende animiert, belastende Bewegungsabläufe ergonomisch auszuführen, teilt die Fraunhofer-Gesellschaft mit. Mit dem modularen Wearable-Soft-Robotics-System wollen die Forscher dem Ausfallrisiko von Arbeitskäften entgegenwirken.
Echtzeit-Bewegungsanalyse
„Alleinstellungsmerkmal unserer softrobotischen Oberkörperorthese ist eine Echtzeit-Bewegungsanalyse“, wird Dipl.-Ing. Henning Schmidt, Wissenschaftler am Fraunhofer IPK, in der Mitteilung zitiert. Eigens entwickelte Algorithmen, die auf Machine Learning und KI basieren, ermöglichten die Ergonomieanalyse. Dadurch unterscheide sich die Orthese von handelsüblichen Exoskeletten, also Stützrobotern, die prinzipbedingt alle – auch unergonomische Bewegungen – einfach nur kraftunterstützen und lediglich die Belastungskräfte des Trägers aus überlasteten in weniger belastete Körperareale umleiten.
Die Bewegungsanalyse der IPK-Orthese hingegen erkennt ergonomische und unergonomische Bewegungen. Per Vibrationsalarm erhält der Träger in Echtzeit Feedback, wenn er Haltungen einnimmt oder Bewegungen ausführt, die gesundheitsschädlich sind. Der Trick: In die Weste integrierte inertiale Bewegungssenoren (IMU, kurz für Inertial Measurement Unit) gleichen vorgelernte Bewegungsmuster mit der tatsächlich ausgeführten Bewegung ab und werten sie in Echtzeit aus. Dieser Vorgang dauert wenige hundert Millisekunden. Die miniaturisierten Bewegungssensoren befinden sich an den Schultern, dem Rücken und den Oberschenkeln.
Vibrationsmodul integriert
Neben den Bewegungssensoren sind eine robuste, miniaturisierte Elektronik inklusive Embedded Controller sowie ein Vibrationsmodul und ein Akku in die Orthese integriert. Für die Entwicklung der miniaturisierten elektronischen Bauteile zeichnet das Fraunhofer IZM verantwortlich, während das Design des Systemlayouts, der Mensch-System-Schnittstelle, der Mechanik, der Elektronik und Software einschließlich des Echtzeitalgorithmus mit maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz am Fraunhofer IPK erfolgt.
Die Datenverarbeitung läuft direkt auf der Weste. „Die Echtzeitalgorithmik erfordert aufwendige Berechnungen und eine sehr hohe Robustheit, dennoch kommt der Anlernprozess der Arbeitskräfte mit einem sehr kleinen Bewegungstrainingsdatensatz aus“, so Schmidt. Derzeit arbeiten die Wissenschaftler des Fraunhofer IZM daran, die Elektronik und die Sensorik der Textilversion der Orthese so zu verkapseln, dass sie waschbar sind und nicht aus der Weste entnommen werden müssen.
Kunden können künftig zwischen einer rein sensorischen Textilweste und einer Variante mit Kraftunterstützung wählen, so die Fraunhofer-Gesellschaft. Eine weitere aktuelle Systemvariante mit Rücken- und Hüftunterstützung wurde mit einer miminal nötigen Orthesenbügel-Auflagefläche am Körper konzipiert.
Durch ein arretierbares seitliches Hüftgelenk an der Weste lässt sich die Kraftübertragung vom Rücken in die Beine ein- und ausschalten. Dieser Mechanismus ermöglicht wechselnde Tätigkeiten im Stehen und Sitzen, heißt es in der Mitteilung.
ErgoJack eignet sich der Mitteilung zufolge für den Einsatz in unterschiedlichsten Branchen. Sowohl Logistiker als auch Produktionsmitarbeiter, die schwere Pakete von Paletten heben müssen oder sich bei Schweißprozessen über Stunden hinweg in einer Zwangshaltung befinden, profitieren davon, wie erfolgreiche Pilottests bei dem Automobilhersteller Ford gezeigt hätten.(eb)
So funktioniert ErgoJack
- Die Bewegungsanalyse der IPK-Orthese erkennt ergonomische und unergonomische Bewegungen.
- Per Vibrationsalarm erhält der Träger in Echtzeit Feedback, wenn er Haltungen einnimmt oder Bewegungen ausführt, die gesundheitsschädlich sind.