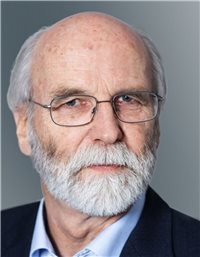Leitlinien gefordert
Heikle Forschung an Hirngewebe
Neurowissenschaftler machen derzeit Schlagzeilen – aufgrund von Mini-Hirnen in der Petrischale oder mit Schweine-Gehirnen, die ex vivo noch Stunden "am Leben" gehalten werden können. 17 Forscher fordern nun, klare Leitlinien zu formulieren und sich schon jetzt mit ethischen Folgen dieser Entwicklung auseinanderzusetzen.
Veröffentlicht:
Aus pluripotenten Stammzellen entstehen im Labor Mini-Organe.
© Dan Race - stock.adobe.com
NEU-ISENBURG. Kopf-Transplantation beim Menschen, außerhalb des Schädels "lebende" Schweine-Gehirne, Mini-Gehirne in der Petrischale – das sind nur einige der intensiv diskutierten Forschungsprojekte, mit denen sich derzeit Neurologen und Neurowissenschaftler befassen.
Klingt teilweise utopisch und unheimlich, ist aber – außer der von dem italienischen Neurochirurgen Professor Sergio Canavero bisher "nur" mehrfach angekündigten Kopftransplantation – tatsächlich Realität.
Wie berichtet, ist es Forschern um Professor Nenad Sestan von der Yale-Universität in New Haven offenbar gelungen, Gehirne von mehr als 100 Schweinen bis zu 36 Stunden ex vivo "am Leben" zu erhalten, nachdem sie erst mehrere Stunden nach dem Tod der Tiere im Schlachthof außerhalb des Körpers mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt worden waren.
Bisher hat Sestan allerdings die zugrunde liegende Technik auf Basis des Systems BrainEx zur Aufrechterhaltung der Mikrozirkulation und die Ergebnisse der Experimente, die noch nicht an die Öffentlichkeit dringen sollten, nicht publiziert.
Einem Bericht im Magazin "MIT Technology Review" von einer Neuroethik-Tagung der "Brain Initiative" zufolge, die die US-Nationalen Gesundheitsinstitute bereits Ende März in Bethesda abgehalten haben, lebten die Gehirnzellen zwar, allerdings ergab sich im EEG ein Bild, das der elektrischen Ableitung in einem komatösen Stadium eines Menschen glich.
Doch schon Anfang der 1990er-Jahre war es gelungen, Gehirne von Meerschweinchen ex vivo am Leben zu erhalten. Durch verbesserte Techniken ist dies nun offenbar Sestan und seinen Kollegen auch bei großen Säugetieren gelungen.
Die bereits von manchen vorgebrachte Idee, die Technik eines Tages auch bei menschlichen Gehirnen nutzen zu wollen, sollte nicht weiter verfolgt werden. Die ethisch-moralischen Probleme ähneln doch zu sehr denen bei der geplanten Kopftransplantation.
Organoid-Forschung weit fortgeschritten
Doch nicht nur die Ex-vivo-Experimente mit den Schweinehirnen lösen heftige Diskussionen über ethische Fragen im Zusammenhang mit einer möglichen Anwendung bei Menschen aus. Auch die Entwicklung der Organoid-Forschung mit der Züchtung von Mini-Gehirnen in der Petrischale ist schon weit fortgeschritten.
Anlass genug für 17 Neurowissenschaftler, unter ihnen Sestan, jüngst ein Statement zu präsentieren, in dem sie ethische Rahmenbedingungen für die Forschung an humanen Hirn-Organoiden und menschlichem Hirngewebe einfordern (Nature 2018; 556; 429–432).
So müssten etwa die Fragen beantwortet werden, ob solche Ex-vivo-Modelle – ausgehend von pluripotenten menschlichen Stammzellen – das heutige Verständnis von Leben und Tod infrage stellten und ob etwa die Herstellung eines menschlichen Herzens im Körper eines Säugetieres akzeptabel sei, nicht dagegen die Züchtung eines Gehirns aus menschlichen Zellen.
Oder die grundsätzliche Frage: Vorausgesetzt, es gelänge, Gehirngewebe zu züchten, das über bewusstes Erleben oder phänomenales Bewusstsein verfügt, verdiente es dann den gleichen Schutz, wie er bisher in der Forschung mit Tieren und Menschen gewährt wird?
Mitunterzeichner ist Professor Christof Koch, ehemaliger Max-Planck-Forscher in Tübingen und heutiger Leiter des Allen Institute for Brain Science in Seattle. Im Zentrum seiner Forschung – gemeinsam mit DNA-Mitentdecker Francis Crick bis zu dessen Tod 2004 – ist die Suche nach dem neuronalen Korrelat für Bewusstsein.
Kein Stopp der Forschung erwünscht
Von einem Stopp der Organoidforschung halten die Neurowissenschaftler nichts. Sie erhoffen sich grundlegend neue Erkenntnisse über neurologische Erkrankungen, die sich in Tiermodellen – an denen sie dennoch festhalten wollen – nicht adäquat abbilden lassen.
Tatsächlich ist es Forschern bereits gelungen, menschliche Hirn-Organoide aus Zellen von Patienten mit Autismus-Spektrum-Störung, Epilepsie oder Schizophrenie zu züchten.
Sie sind sogar in der Lage, mithilfe solcher Organoide die Entstehung der Mikrozephalie im Zusammenhang mit einer Zikavirus-Infektion zu erforschen. Nicht zuletzt das Gen-Editieren mithilfe der einfachen und präzise einsetzbaren CRISPR-Technik (clustered regularly interspaced short palindromic repeat) beschleunigt die Organoid-Forschung auch in den Neurowissenschaften.
Und Organoide unterschiedlicher Hirnregionen lassen sich bereits "verschmelzen" und so Interaktionen in der Hirnentwicklung besser erforschen. Davon, eines Tages Hirn-Organoide mit einer Form von Bewusstsein züchten zu können, sind die Forscher jedoch weit entfernt.
Dimension der Mini-Gehirne begrenzt
Das größte Hindernis in der Züchtung von Organoiden war bisher die begrenzte Dimension: Ohne Vaskularisierung wachsen die Zellhaufen nur bis zu maximal 4 mm im Durchmesser, das sind zwei bis drei Millionen Neuronen – verschwindend wenig im Vergleich zum erwachsenen Gehirn mit seinen etwa 86 bis 100 Milliarden Neuronen.
Das könnte sich künftig ändern, weil es inzwischen Forschern gelungen ist, Hirn-Organoide mit patienteneigenen Endothelzellen auszustatten (Neuroreport. 2018; 29/7: 588-593) und auch in Versuchstieren vaskularisiert wachsen zu lassen.
Ein erster Schritt zu Organoiden, die größer und weiter entwickelt sind. Das wird nicht nur die Züchtung von Hirn-Organoiden beflügeln, sondern auch anderer Organoide etwa von Darm, Pankreas, Lunge und Niere sowie von soliden Tumoren – und die ethische Debatte weiter befeuern.
Deshalb ist der Aufruf der 17 Neurowissenschaftler so wichtig, wie es der Leitfaden niederländischer und österreichischer Wissenschaftler von Anfang 2017 für die Forschung an menschlichen Organmodellen allgemein ist (Science 2017: 355/6322: eaaf9414).