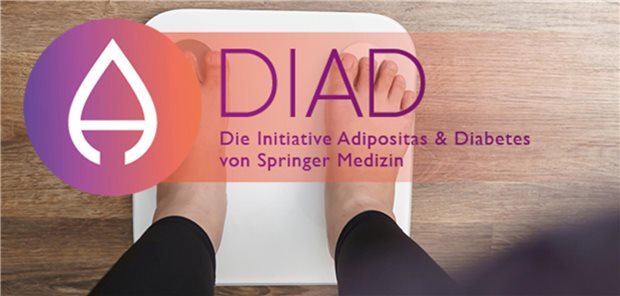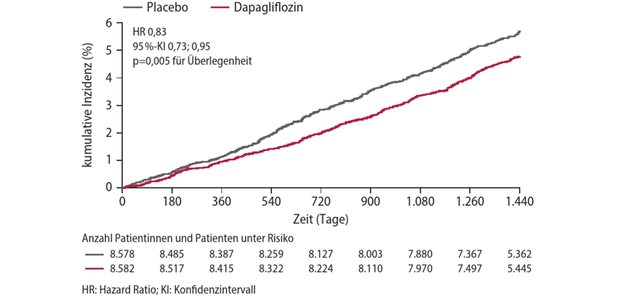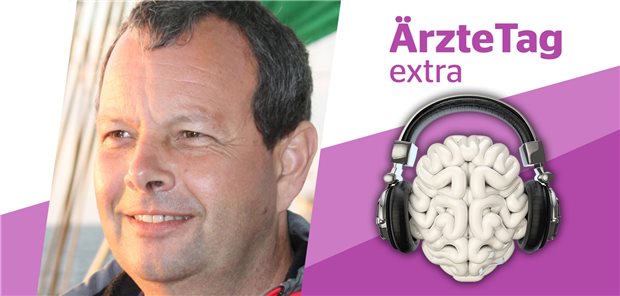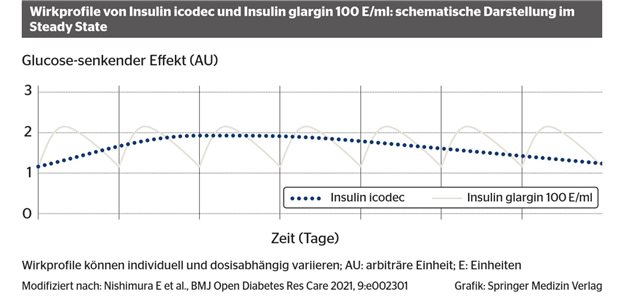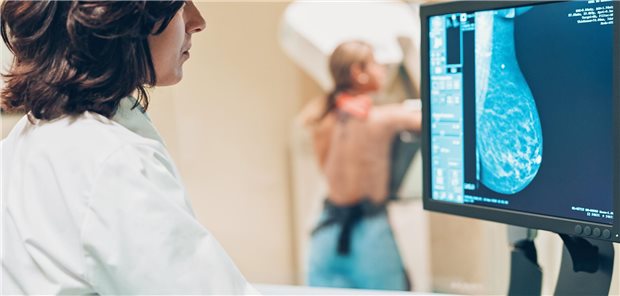Unterzucker beim OGTT
Doch kein Hinweis auf das Diabetes-Risiko?
Eine Hypoglykämie beim OGTT gilt als Indikator für ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes. Neue Studiendaten sprechen dagegen.
Veröffentlicht:LEICESTER. Eine biochemisch definierte Unterzuckerung (Plasma-Glukose unter 60 mg / dl) ist ein häufiger Befund beim oralen Glukosetoleranztest (OGTT).
Im Gegensatz zur gängigen Ansicht spricht diese Form der Hypoglykämie eher für einen positiven Phänotyp in puncto Insulinresistenz, wie britische Forscher um die Diabetologin Danielle Bodicoat von der Universität Leicester berichten (Diab Res Clin Pract 2014, online 4. März).
Sie haben Daten von knapp 6500 gesunden Probanden analysiert, die einen OGTT mit 75 g Glukose absolviert hatten. 5,5 Prozent entwickelten eine biochemisch definierte Unterzuckerung zwei Stunden nach dem Zuckertrunk.
Bei 16,7 Prozent wurde eine gestörte Glukosetoleranz (IGT) festgestellt (Nüchternglukose 110 bis 126 mg / dl und / oder Zwei-Stunden-Glukose 140 bis 200 mg / dl). Die übrigen Probanden, 77,8 Prozent, hatten eine normale Glukosetoleranz.
Das Profil der Probanden mit Unterzucker nach OGTT war günstiger als bei Probanden mit IGT oder normaler Glukosetoleranz: Sie waren jünger, hatten einen geringeren BMI, höhere HDL-Werte, eine ausgeprägtere Insulinsensitivität sowie niedrigere Blutdruck-, Nüchternglukose- und Triglyzerid-Werte.
Hypoglykämien nach Glukosebelastung interpretierte man bisher als Hinweis auf eine frühe Dysfunktion der Betazellen und auf eine Insulinresistenz.
So besteht etwa beim polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS) eine Insulinresistenz, die zu einer Nüchternhyperinsulinämie führt. Diese wiederum macht die Betazellen unempfindlich für Blutzucker-Schwankungen.
In Folge schwächt sich die Insulin-Erstantwort auf den postprandial steigenden Glukosespiegel ab. Dafür fällt die Zweitantwort überschießend aus und zieht eine Hypoglykämie nach sich. (rb)