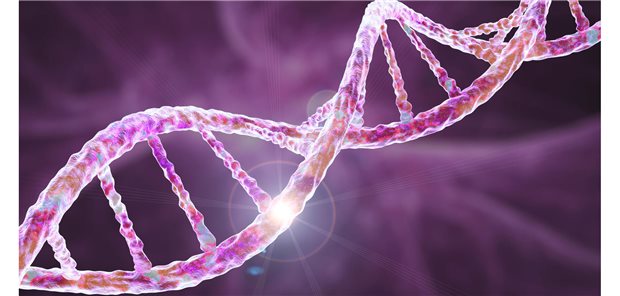Bipolarstörung
Erster Welttag für bessere Therapie
Hin- und hergerissen zwischen Lachen und Weinen: Die Diagnose von Bipolarstörungen erfolgt spät, nur wenige Patienten werden behandelt, die Komorbiditäten kaum beachtet. Folge: eine hohe Suizidrate und eine um neun Jahre verkürzte Lebenserwartung. Ein neuer Welttag soll das ändern.
Veröffentlicht:
Mal euphorisch, mal deprimiert: Bei Mischformen der Bipolarstörung treten beide Phasen im kurzen Wechsel oder sogar gleichzeitig auf.
© Alina Solovyova-Vincent / iStock / Getty Images
HAMBURG. Den 30. März für den Welttag zu Bipolaren Störungen haben die drei Initiatoren gewählt, weil an diesem Datum - im Jahr 1853 - Vincent van Gogh geboren wurde. Medizinhistoriker haben den niederländischen Maler posthum als bipolar erkrankt diagnostiziert.
Die Ziele der Kampagne beschreibt die in Hamburg ansässige Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen e.V. (DGBS) so: Abbau von Stigmatisierung, Hilfe für Patienten und Angehörige, Sensibilisierung der Ärzte für das erhöhte Risiko körperlicher Komorbiditäten, Beschleunigung der Diagnose, Verbesserung bei der Therapie sowie Förderung von Forschung und Weiterbildung.
Für Mai plant die DGBS eine "Bipolar Roadshow" durch acht deutsche Städte. Die gesellschaftlichen und medizinischen Folgen der Störung sind eminent. Sie gehört zu den häufigsten psychiatrischen Erkrankungen.
Zwei bis fünf Prozent der Bevölkerung erkranken hierzulande im Lauf ihres Lebens daran, Männer und Frauen zu gleichen Teilen. Das entspricht nach Angaben der DGBS zwei Millionen Menschen. Die Stimmungsschwankungen bringen erhebliche private und berufliche Schwierigkeiten mit sich.
Die Lebenserwartung ist um neun Jahre verkürzt. Eine schwedische Registerstudie über sieben Jahre ergab eine doppelt so hohe Sterberate wie bei der übrigen Bevölkerung. Zumindest teilweise lässt sich das mit einem erhöhten Risiko für körperliche Erkrankungen und Suizid, mit verspäteter Diagnose und Suchtproblemen erklären (JAMA Psychiatry 2013 70 (9): 931).
Doppelt so viele Patienten wie in der übrigen Bevölkerung sterben demnach an kardiovaskulären Krankheiten, doppelt so viele an Darmkrebs, dreimal so viele an Typ-2-Diabetes, zweieinhalb Mal so viele an COPD, viermal so viele an Influenza oder Pneumonie. Die Krebsrate bei Frauen ist um etwa ein Drittel gesteigert.
Hoffnung von Laborärzten
Die Suizidrate ist bei Frauen mit Bipolar-Erkrankung zehnfach, bei Männern achtfach erhöht. 5,4 Prozent dieser Frauen und knapp zehn Prozent der Männer sterben durch eigene Hand. Allerdings lassen sich damit nur zwei der um neun Jahre verkürzten Lebenserwartung erklären.
Viele Bipolar-Patienten haben einen ungesunden Lebensstil: Bei 12,2 Prozent der Studienteilnehmer war Alkoholsucht im Register vermerkt - im Vergleich zu 1,8 Prozent in der Allgemeinbevölkerung. Auch Zigarettenrauchen und Drogenmissbrauch sind bei ihnen verbreitet.
Nur zehn bis 15 Prozent der Patienten werden behandelt. Mit einer Lithium-Monotherapie als Referenz war die Sterberate ohne Therapie um etwa 60 Prozent erhöht und die Suizidrate verdoppelt, doch auch bei einer Monotherapie mit den am häufigsten verwendeten Antipsychotika und Antikonvulsiva war die Sterberate um 30 bis 40 Prozent höher.
Die genetisch und biologisch mitbedingte Störung muss lebenslang behandelt werden: mit Stimmungsstabilisatoren (Antiepileptika, Neuroleptika), mit u.a. Antidepressiva und Sedativa zur Akutintervention, mit Psycho- und Elektrokrampftherapie.
Die Kehrseite: Einige Arzneien wirken sich metabolisch ungünstig aus. Vielversprechend ist die Magnetstimulation bei therapieresistenten gemischten Phasen: In einer Pilotstudie sprach jeder Zweite an (J Affect Disord 2014; 157: 66-71).
Bis zur Diagnose haben die Patienten im Schnitt drei bis fünf Ärzte konsultiert und mehrere Therapieversuche hinter sich. Dabei hänge die Prognose von Früherkennung und rascher Behandlung ab, moniert die DGBS. Hoffnung versprechen Laborärzte: Derzeit entwickeln sie einen Bluttest zur Unterscheidung von Schizophrenie, Depression und Bipolarstörung.
Doch auch die späte Diagnose der körperlichen Begleiterkrankungen ist ein kritischer Faktor. Denn Bipolar-Patienten mit bekannter kardiovaskulärer Krankheit sterben nicht früher als psychisch gesunde Herzkreislaufpatienten. Offenbar ist ihre medizinische Versorgung also besonders schlecht.