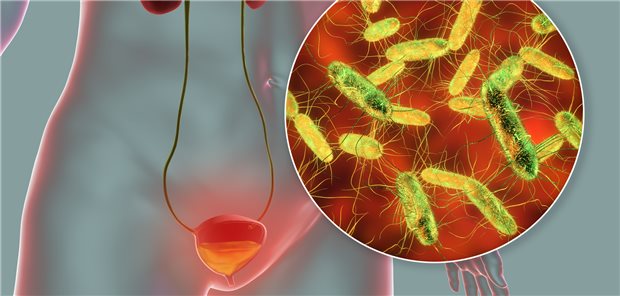Soziale Medien
„Fake News“ dominieren Infos zu Prostatakrebs
Sieben von zehn der populärsten Beiträge zu Prostatakrebs auf Facebook, Twitter & Co waren in einer Analyse falsch oder irreführend. Bei Artikeln zu anderen Urogenitaltumoren sieht es etwas besser aus.
Veröffentlicht:
Richtig oder falsch? Fehlinformationen zur Urogenitaltumoren, vor allem Prostatakrebs scheinen sich im Web schnell zu verbreiten.
© keport / Getty Images / iStock
Das Wichtigste in Kürze
Frage: Wie oft werden Fehlinformationen zu Urogenitaltumoren auf sozialen Netzwerken verbreitet?
Antwort: Sieben der zehn populärsten Beiträge zu Prostatakrebs basieren auf wissenschaftlich falschen oder irreführenden Informationen.
Bedeutung: Auf sozialen Netzwerken werden überwiegend „Fake News“ zu Urogenitaltumoren im Allgemeinen und zu Prostatatumoren im Besonderen verbreitet.
Einschränkung: Es wurde nur eine kleine Zahl von Beiträgen ausgewertet.
LOMA LINDA. Sich in sozialen Netzwerken über Krebserkrankungen zu informieren ist mitunter keine gute Idee. Der Wahrheitsgehalt der kursierenden Beiträge ist eher gering, häufig dominieren falsche oder irreführende Informationen, berichten Urologen um Dr. Muhannad Alsyouf von der Universität in Loma Linda in Kalifornien in einem vor kurzem publizierten Beitrag in der Fachzeitschrift „Urology“(doi.org/10.1111/bju.14787).
Ein Team um Alsyouf hat sich gezielt die populärsten Beiträge zu Urogenitaltumoren angeschaut und kommt zu einem vernichtenden Fazit: Die am häufigsten geteilten Posts und Links enthalten zum großen Teil „Fake News“, vor allem solche zu Prostatakrebs.
Urologen prüften 50 Artikel
Die Urologen um Alsyouf screenten mit einem speziellen Webtool englischsprachige Beiträge zu Prostatakrebs, Blasenkrebs, Nierenkrebs, Hodenkrebs und PSA-Tests. Alle sind zwischen August 2017 und August 2018 über Facebook, Twitter, Pinterest und Reddit verbreitet worden.
Das Tool lieferte auch Angaben, wie häufig die Beiträge geteilt wurden. Zu jedem der fünf Themen wählten sie die zehn Beiträge aus, die auf den Netzwerken am meisten gestreut wurden.
Zwei Urologen prüften den Inhalt der insgesamt 50 Artikel, indem sie die Aussagen mit denen aus Leitlinien, Konsensuspapieren oder anderen wissenschaftlichen Publikation verglichen. Entsprechend beurteilten sie den Inhalt als „zutreffend“, „ungenau“ oder „irreführend“.
Mit dem Etikett „ungenau“ markierten sie Beiträge mit Aussagen, die dem Stand der Wissenschaft widersprechen oder keine wissenschaftliche Basis haben, als „irreführend“ solche, die zwar auf Fakten beruhen, diese aber falsch interpretieren.
Als Beispiele nennen die Urologen Resultate von Tierexperimenten, die einfach auf Menschen übertragen werden.
Sieben von zehn Artikeln zu ungenau
Die 50 ausgewählten Artikel wurden insgesamt 550.000-mal geteilt, vor allem auf Facebook und Twitter. Mit Abstand am häufigsten verbreiteten sich die zehn Beiträge zu Prostatakrebs (400.000-mal), gefolgt von Nierenkrebs (115.000-mal), Blasenkrebs (18.000-mal), PSA-Test (9.000-mal) und Hodentumoren (7.000-mal).
Ausgerechnet die Beiträge zu Prostatakrebs enthielten am häufigsten Fake News: Sieben von zehn wurden als ungenau (4) oder irreführend (3) beurteilt, deutlich besser sah es bei den anderen Themen aus: Falsche oder irreführende Aussagen enthielten nur ein bis drei der Beiträge, und neun von zehn Posts und Links zu PSA-Tests beruhten auf wissenschaftlich korrekten Aussagen.
Schauten sich die Forscher die einzelnen Beiträge über alle Themen an, so wurden solche mit wissenschaftlichen Falschaussagen im Schnitt 54.000-mal geteilt, korrekte nur 1900-mal – Fake News verbreiteten sich also 28-fach öfter.
Zumeist wurden in den Fake News alternativmedizinische Verfahren zur Krebstherapie empfohlen, obwohl für diese kein Nutzen belegt war (acht Beiträge, 433.000-mal geteilt). Vier Beiträge enthielten unzureichende Empfehlungen zur Selbstdiagnose.
Die meisten der Beiträge drehten sich um Diagnose und Therapie, die allerwenigsten stammten von einer offiziellen Seite oder von Ärzten und Kliniken.
Fake News 28-fach häufiger verbreitet als korrekte Beiträge
Die Urologen um Alsyouf stellen fest, dass zwar die meisten (35 von 50) der ausgewerteten Beiträge faktisch richtig waren, sich die Fake-News-Berichte aber um ein Vielfaches stärker verbreiteten als solche mit wissenschaftlich korrekten Angaben. Entsprechend säßen die User von sozialen Netzwerken wohl überwiegend Falsch- und Fehlinformationen zu Urogenitaltumoren auf.
Ähnliches sei auch in Analysen zu anderen Krankheiten festgestellt worden.
Fehlinformationen in sozialen Netzwerken könnten Therapieentscheidungen erschweren und die Gesundheit der User gefährden. Als Gegenmittel wird empfohlen, wissenschaftliche Evidenz und Leitlinien auch verstärkt auf Facebook & Co zu präsentieren.
Lesen Sie dazu auch: In der Fake-News-Blase