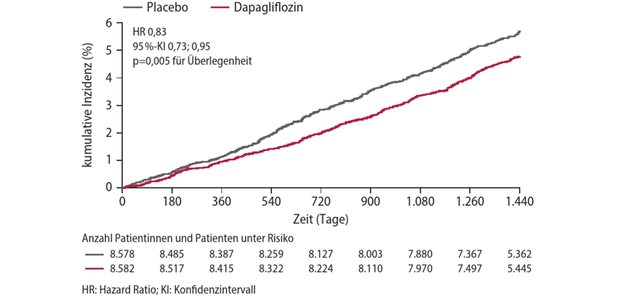Mehnert-Kolumne
Gibt es ein "humaneres" Insulin als Humaninsulin?
Noch sind wir weit davon entfernt, die Wirkungsweise des körpereigenen Insulins nachahmen zu können. Ein Schritt in diese Richtung ist aber mit der Einführung der Analoga getan worden.
Veröffentlicht:Prof. Hellmut Mehnert
Arbeitsschwerpunkte: Diabetologie, Ernährungs- und Stoffwechselleiden: Diesen Themen widmet sich Prof. Hellmut Mehnert seit über 50 Jahren.
Erfahrungen: 1967 hat er die weltweit größte Diabetes-Früherfassungsaktion gemacht sowie das erste und größte Schulungszentrum für Diabetiker in Deutschland gegründet.
Ehrung: Er ist Träger der Paracelsus-Medaille, der höchsten Auszeichnung der Deutschen Ärzteschaft.
Wir spritzen Insulin am falschen Ort und zum falschen Zeitpunkt, und wir spritzen das falsche Insulin. Diese Aussage zur Behandlung mit dem Hormon als Medikament gibt es schon lange und sie lässt sich bisher auch nicht widerlegen.
Das verdeutlicht der Vergleich der Eigenschaften des körpereigenen endogen produzierten Insulins mit den Eigenschaften von Arzneimitteln, sei es mit Insulin-Analoga oder auch mit Humaninsulin. Im Vergleich mit Humaninsulin ahmen aber moderne Insulin-Analoga die Wirkprofile des endogenen Insulins deutlich besser nach.
Endogenes Insulin geht in die Leber
Das körpereigene Insulin gelangt bekanntlich über die Pfortader zuerst in die Leber, wo es wichtige Eigenschaften entfaltet. Das ist ein gravierender Unterschied zur subkutanen Injektion von Humaninsulin oder Analoga. Die in der Therapie verwendeten Insuline oder Insulinabkömmlinge werden daher zwangsläufig am falschen Ort gespritzt.
Etwas anders sieht es schon aus, wenn man die Zeitpunkte der Insulinsekretion oder der Verabreichung des Hormons als Medikament miteinander vergleicht. Zwar kann man das Ideal, dass der Körper unmittelbar auf eine Erhöhung des Blutzuckers reagiert und endogenes Insulin sezerniert (pulsatil, rasch und auch basal wirksam) mit einem Arzneimittel bisher nicht erreichen.
Die kurzwirksamen Analoga können aber - etwa im Rahmen einer ICT - in Form von Lispro, Aspart oder dem besonders kurz wirksamen Glulisin unmittelbar vor oder sogar kurz nach dem Essen gespritzt werden. Bei der Therapie mit Humaninsulin ist hingegen ein Spritz-Ess-Abstand der Injektionen vor der Mahlzeit nötig.
Auch die langwirkenden Analoga ahmen die Basalsekretion ohne nachteiliges Wirkungsmaximum im Vergleich zum NPH-Humaninsulin wesentlich "physiologischer" nach. Das gilt besonders für das über 24 Stunden wirksame Insulin glargin.
Das Fazit: Beim Eintritt und beim Verlauf der Insulinwirkung haben die Analoga bereits einen deutlichen Vorsprung vor Humaninsulin.
Analoga haben die Nase vorn
Gibt es also ein "humaneres" Insulin als das Humaninsulin? Ja, im Vergleich haben die Analoga die Nase vorn: Die kurzwirksamen Analoga wirken rascher als normales Humaninsulin und ahmen damit den Wirkungseintritt des endogenen Insulins besser nach.
Ein Nachteil von NPH ist auch das Wirkungsmaximum nach der Injektion, das im Vergleich zu häufigeren vor allem nächtlichen Hypoglykämien führen kann. Auch hier haben die langwirkenden Analoga Glargin und Detemir mit ihren flachen Wirkprofilen Vorteile.
Und schließlich lassen sich die Analoga leichter handhaben: Sie müssen - im Gegensatz zur trüben NPH-Insulin-Suspension - vor der Injektion mit dem Pen nicht geschwenkt werden. Auch das ist im Vergleich "physiologischer": Oder hat man jemals davon gehört, dass sich ein Mensch vor Eintritt der endogenen Insulinwirkung schütteln muss?
Noch sind wir weit davon entfernt, die Wirkungsweise des körpereigenen Insulins nachahmen zu können. Ein Schritt in diese Richtung ist aber mit der Einführung der Analoga getan worden. Weitere Verbesserungen der Insulintherapie sind zu erwarten. Man denke nur an die Anstrengungen zur Entwicklung eines künstlichen Pankreas.



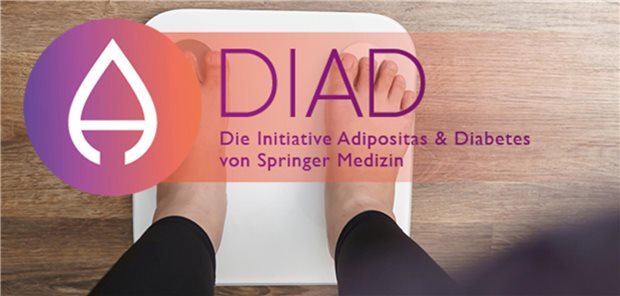







![Die Schilddrüse tickt in jedem Lebensalter anders Porträts: [M] Feldkamp; Luster | Hirn: grandeduc / stock.adobe.com](/Bilder/Portraets-M-Feldkamp-Luster-Hirn-grandeduc-stockadobecom-235723.jpg)