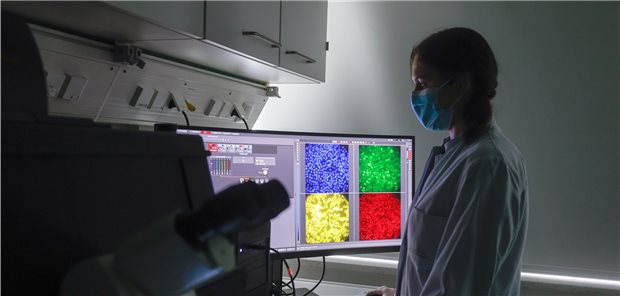Krebsforschung
Onkologie: Fast patientenfreie Grundlagenforschung in Deutschland
Die Patientenbeteilung an der Krebsforschung steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen – obwohl beide Seiten davon profitieren können. Das Deutsche Krebsforschungszentrum weist auf Hintergründe und Lösungen hin.
Veröffentlicht:
Speziell in der onkologischen grundlagenforschung konzentrieren sich Forscher in Deutschland mehr auf das Material als auf die Patienten, konzediert das Deutsche Krebsforschungszentrum.
© Andrés Benitez / Westend61 / picture alliance
Heidelberg. Um die Krankenversorgung onkologischer Patienten zu verbessern, binden Kliniken Betroffene zum Beispiel über Patientenbeiräte inzwischen regelmäßig ein. In der Forschung werden Patientinnen und Patienten bisher noch zu wenig, aber inzwischen immer mehr einbezogen, konstatiert das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Ein wichtiges Ziel der Nationalen Dekade gegen Krebs ist es explizit, die Beteiligungen von Patientinnen und Patienten in der Krebsforschung auszubauen.
Damit marschiert Deutschland in die Richtung der inzwischen unter dem Dach der deutsch-slowenisch-portugiesischen EU-Trioratspräsidentschaft konsentierten „Prinzipien für eine erfolgreiche Patientenbeteiligung in der Krebsforschung“ (Principles of Successful Patient Involvement in Cancer Research), die Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) im September in Berlin vorgestellt hat.
Unterschiedliche Erwartungen
Wie das DKFZ auf seiner Website klarstellt, meint Patientenbeteiligung in der Forschung nicht nur, dass Betroffene in (klinischen) Studien mitwirken und/oder die im Zusammenhang mit ihrer Krankheit erhobenen Daten für Forschungszwecke zur Verfügung stellen.
„Es geht auch darum, dass Betroffene in allen Phasen der Forschung – das bedeutet von der Formulierung der Fragestellung bis zur Verwertung der Ergebnisse – eingebunden werden. Ihre Wünsche, Erfahrungen und Meinungen sollen gehört und berücksichtigt werden“, so das DKFZ.
Denn davon profitierten beide Seiten. Die Forschenden lernten eine andere Sichtweise auf ihr Forschungsfeld kennen und erhielten wertvolle Einblicke in die Bedürfnisse, Sorgen und Nöte von denjenigen, zu deren Wohl sie forschten. Aus Befragungen sei bekannt, dass Patientinnen und Patienten manchmal andere Dinge wichtig sind als den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Patienten im Mittelpunkt
Krebsforschung: EU fordert mehr Patientenbeteiligung ein
Während Forschende sich zum Beispiel mitunter eher zum Ziel setzten, bekannte Therapien so zu verbessern, dass sie Betroffenen ein längeres Leben ermöglichen, liege der Fokus der Patientinnen und Patienten manchmal mehr darauf, dass Erkenntnisse vertieft werden oder bereits bestehende Therapien zugunsten der Lebensqualität weiterentwickelt werden.
Umgekehrt nütze die Einbindung in allen Phasen der Forschung den Patientinnen und Patienten. Ihre Sicht auf ihre Erkrankung, ihre Erfahrungen und auch ihre Wünsche flössen unmittelbar in die Arbeit derer ein, die mit ihrer Forschung immer erreichen wollen, dass Krebserkrankungen besser verstanden und somit häufiger verhindert und besser geheilt werden können.
Patientenbeteiligung steht ganz am Anfang
Das DKFZ warnt davor, angesichts der Nationale Dekade gegen Krebs schon in Euphorie auszubrechen, denn: „Die Patientenbeteiligung in der Forschung steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Besonders im Bereich der Grundlagenforschung findet eine Mitwirkung von Patientinnen und Patienten bisher praktisch nicht statt.“
Hintergrund seien Vorbehalte auf beiden Seiten: Forscher seien oft skeptisch, inwieweit Betroffene genügend über wissenschaftliches Arbeiten und Forschungsprozesse wissen, um sinnvoll einen Beitrag zu ihrer Arbeit leisten zu können. Umgekehrt fürchteten Patienten, in der Forschung nur dort ernstgenommen zu werden, wo sie – zum Beispiel als Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer – unerlässlich sind. „Hier müssen also beiderseitig Berührungsängste abgebaut werden“, so das DKFZ.
Dafür könnten Patientenakademien wie EUPATI, die Europäische Patientenakademie, hilfreich sein, betont das DKFZ. EUPATI wird unter anderem von Patientenorganisationen getragen und ist schwerpunktmäßig in den Bereichen Aus- und Weiterbildung aktiv. Ziel ist es, die Fähigkeit von Patientinnen und Patienten auszubauen, die medizinische Forschung und Entwicklung zu verstehen und sich daran zu beteiligen – explizit auch in der onkologischen Forschung.
Einen ersten Schritt in Richtung der stärkeren Einbindung von Betroffenen in die Grundlagenforschung ist das DKFZ in Heidelberg nach eigener Aussage mit dem Ende 2018 etablierten „Patientenbeirat Krebsforschung“ gegangen. Über diesen Beirat werde die Perspektive von Patientinnen und Patienten bei der Weiterentwicklung der Forschungsstrategie des DKFZ und seiner klinischen Forschungsnetzwerke berücksichtigt. Das soll auch positiv ausstrahlen auf den Strategiekreis der Nationalen Dekade gegen Krebs.