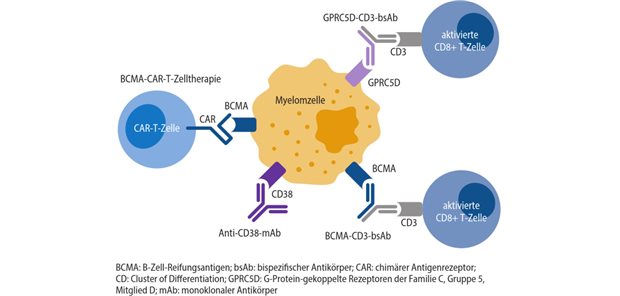Seltene Erbkrankheit
Ursache für AEC-Syndrom entdeckt
FRANKFURT / MAIN. Mutationen im p63-Gen führen zu vielen Krankheits-Syndromen, aber keines ist so schwerwiegend wie das AEC (Ankyloblepharon-Ektodermaldysplasie-Clefting)-Syndrom. p63 fungiert als Transkriptionsfaktor in den Stammzellen der Epidermis und reguliert deren Entwicklung und Vermehrung. Mutationen in einem bestimmten Bereich des Proteins verursachen das lebensgefährliche AEC-Syndrom.
Die Krankheit ist unter anderem dadurch charakterisiert, dass Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten zur Welt kommen und andauernde Erosionen erleiden, vergleichbar mit starken Verbrennungen. Einzelne Symptome können operativ behoben oder gelindert werden. Ein Ansatz zur Behandlung des Ursprungs hingegen war bisher aufgrund des fehlenden Verständnisses über die mutierten p63 Moleküle unmöglich.
Den Grund dafür haben Forscher der Goethe-Uni Frankfurt (JGU) und der Uni Neapel über verschiedene Labormethoden und im Mausmodell nun entdeckt: Die Mutationen, die das AEC-Syndrom verursachen, beschränken sich auf zwei bestimmte Domänen von p63 (PNAS 2018; online 16. Januar).
Diese Domänen gelten als Plattformen für Protein-Protein-Interaktionen und daher wurde als Krankheitsursache ein Verlust von Bindepartnern vermutet, erinnert die JGU. "Stattdessen konnten wir zeigen, dass die Mutationen zur Freilegung von hydrophoben Aminosäuresequenzen führen, die sich in der Zelle zusammenlagern und große, unstrukturierte Komplexe bilden", wird Studienautor Professor Volker Dötsch in der Mitteilung zitiert.
Dadurch verliere das mutierte p63 seine Funktionen als Stammzellfaktor. Ähnliche Arten von Protein-Aggregaten sind auch die Ursache für andere Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson oder ALS. Zudem stellten die Forscher fest, dass p63 durch Auflösung der Aggregate seine Funktion wiedererlangt. Damit eröffne sich ein neuer Weg zu einer Behandlung des AEC-Syndroms. (eb)