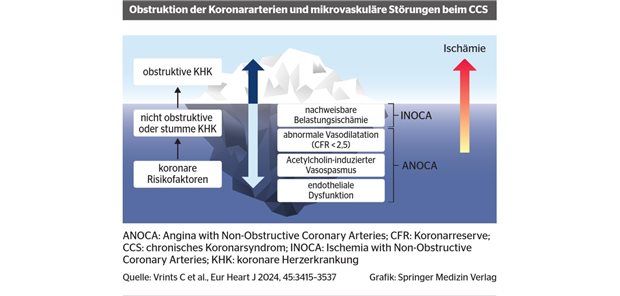Vier Wirkstoffe brauchen Patienten nach einem Herzinfarkt
FRANKFURT AM MAIN (hbr). Die Sterberate von Herzinfarkt-Patienten kann durch die Kombination von einem Statin, ASS, einem Betablocker und einem ACE-Hemmer erheblich gesenkt werden. Senioren und Diabetiker erhalten immer noch zu selten eine Statin-Therapie.
Veröffentlicht:Patienten sollten nach einem Herzinfarkt routinemäßig mit einem Statin, ASS, mit einem Betablocker und einem ACE-Hemmer behandelt werden - Präparate aus allen vier Substanzklassen gehören in die Therapie, so lange keine Kontraindikation vorliegt, hat Professor Jochen Senges vom Herzzentrum in Ludwigshafen bei einer Veranstaltung in Frankfurt am Main berichtet. Die Sterberate könne durch den Einsatz der Wirkstoffe halbiert werden.
Belegt hat das eine neue Auswertung der Daten von 5745 Patienten nach Herzinfarkt, die im MITRA-Register (Maximale Individuelle TheRapie des Akuten Infarkts) erfaßt wurden. Vor zehn Jahren noch erhielten Patienten im Mittel 2,4 dieser Wirkstoffe, vor fünf Jahren waren es bereits 3,5.
Der Erfolg: "Dieses leitliniengerechte Therapieverhalten hat zu einer markanten Senkung der Langzeitsterberate geführt: von ursprünglich zehn Prozent in den ersten 18 Monaten nach dem Infarkt auf nur noch 4,8 Prozent", sagte Senges bei einem Symposium von MSD Sharp & Dohme und Essex.
Präparate aus jeder einzelnen Wirkstoffklasse tragen zur Verminderung der Komplikationsrate bei. Wurden zum Beispiel nur zwei davon verwendet, dann hatte in den 1,5 Jahren nach der Krankenhaus-Entlassung jeder zweite Patient eine schwerwiegende Komplikation wie Tod, Reinfarkt oder Apoplexie. Bei drei Präparaten waren es bereits weniger als 40 und bei vier unter 20 Prozent. Bezogen auf den kombinierten Endpunkt Tod, Re-Infarkt und Revaskularisation seien Statine am effektivsten, an zweiter Stelle folgten die Betablocker. Von ACE-Hemmern profitierten Patienten mit Diabetes oder eingeschränkter Pumpfunktion gut, so Senges.
Allerdings werden Statine seiner Ansicht nach zu selten verwendet. So hatte nur jeder fünfte von 14 000 Patienten mit akutem Koronarsyndrom eine Statin-Vortherapie. Dabei war bei jedem zweiten bereits vorher eine Koronarerkrankung oder eine Erkrankung mit gleich hohem Risiko wie Diabetes oder AVK bekannt. Besonders Patienten über 70 Jahre und Diabetiker würden oft untertherapiert, sagte er.
Diabetes-Patienten etwa erhielten nur halb so oft ein Statin wie Nichtdiabetiker, "obwohl sie es am meisten bräuchten." Auch Senioren können im Hinblick auf Mortalität und Re-Infarktrate durch die rasche Wirkung profitieren, schon bei einer Lebenserwartung von einem halben Jahr. Die Konsequenzen der Untertherapie, so Senges: Nach dem ersten Herzinfarkt beträgt die Hospital-Sterberate bei vorher nicht mit Statinen behandelten Patienten zehn Prozent. Mit Statintherapie dagegen nur 6,3 Prozent.