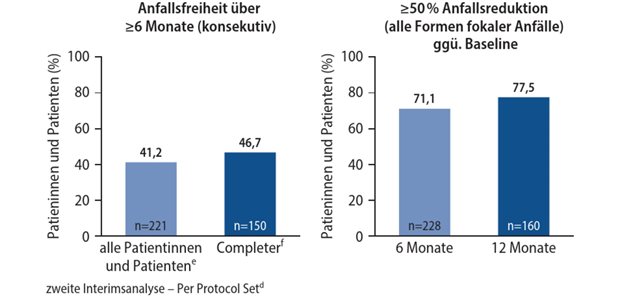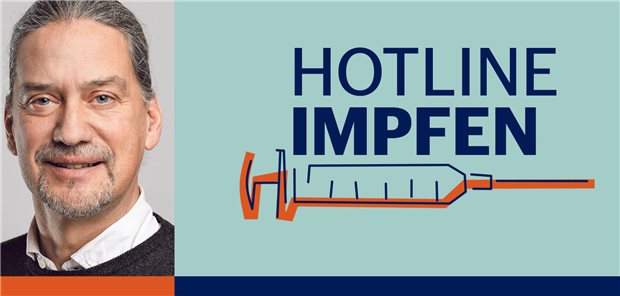Infektiöser Trump im Dienst
Kranke Politiker und der Makel der Schwäche
Politiker werden für ihre persönliche Kraft und Gesundheit gewählt – müssen dann aber auch liefern. Und so versuchen manche wie der COVID-19-erkrankte US-Präsident Trump keine Schwäche zu zeigen. „Toxische Männlichkeit“ nennt das ein Politpsychologe.
Veröffentlicht:
Ein Bild, das um die Welt ging: US-Präsident Trump verlässt das Krankenhaus in Bethesda und lässt sich in seiner Limousine – zu diesem Zeitpunkt noch hoch infektiös – an seinen Anhängern vorbeikutschieren.
© Tonypeltier/AP/dpa
Neu-Isenburg. Triumphal fuhr US-Präsident Donald Trump trotz seiner COVID-19-Erkrankung in einer Limousine zu seinen Fans, die vor seinem Krankenhaus warteten. Der Führer der freien Welt könne sich nicht verschanzen, hatte er zuvor in einer Video-Botschaft erklärt. Nur keine Schwäche vorschützen!
Das zeigt, dass das, was der Politikpsychologe Professor Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal eine „toxische Männlichkeit“ nennt, bei Politikern weiter populär ist. Trumps Hubschrauber-Landung vor dem Weißen Haus, bevor er ins Oval Office zurückkehrte, glich denn auch der Epiphanie eines Erlösers.
Trump erntete mit seinen Auftritten beides: Unverständnis und Begeisterung. Seine Anhänger jubelten, seine Kritiker schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Denn Trump war offenbar noch krank und womöglich infektiös. Einen derart krachledernen Umgang mit der eigenen Gesundheit zeigten Politiker indessen schon seit Jahr und Tag.
Helmut Kohl ignorierte auf dem Parteitag 1989 seine heftigen Unterleibsschmerzen. Er fürchtete, gestürzt zu werden, wenn er in der innerparteilich kritischen Situation den Parteitag verließe. Also biss er die Zähne zusammen und überstand den Putschversuch.
Kohls Schmerzen, Brandts Psyche
Die Depressionen von Willy Brandt zwangen den Politiker immer wieder aufs Lager. Bekannt wurde davon während seiner Amtszeit fast nichts. Zu groß dürfte die Furcht gewesen sein, dass Projekte wie der „Wandel durch Annäherung“, an der veröffentlichten Gemütsverfassung des Bundeskanzlers scheitern könnten.
Ganz zu schweigen von den verschwiegenen Schmerzen, die der Sonnyboy unter den amerikanischen Präsidenten, John F. Kennedy, unterdrückte, um seine Aufgaben zu erfüllen. Oder dem Tablettenkonsum von Leonid Breschnjew.
Aber: Die Zeiten ändern sich. Das zeigt zum Beispiel die Pressekonferenz von Manuela Schwesig (SPD), der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Die Diagnose Brustkrebs habe sie und ihre Familie schwer getroffen, sagte Schwesig vor den Kameras und weiter: Sie habe ihre Ministerinnen und Minister gebeten, sie im Polit-Betrieb an den Therapietagen zu vertreten. Damit hat sie sich praktisch als ersetzbar gezeigt, und dieser offene Umgang mit ihrer Erkrankung und ihrer Funktion dürfte ihr eine Menge Sympathiepunkte eingebracht haben.
Mike Mohring, CDU_Landesvorsitzender und Oppositionsführer im thüringischen Landtag, machte seine Krebserkrankung in einem selbst gedrehten Video öffentlich. Wolfgang Bosbach (CDU) berichtete offen über seine Prostatakrebs-Erkrankung und Guido Westerwelle von der FDP schrieb sogar ein Buch über seine Leukämie-Erkrankung: „Zwischen zwei Leben“.
Krankheit ist nicht gleich Krankheit
Aber Krankheit ist nicht gleich Krankheit. „Krankheiten, die die Urteils- und Handlungsfähigkeit beeinträchtigen können, also die mit Abhängigkeiten oder psychischen Symptomen behaftet sind, zum Beispiel die Volkskrankheit Depression, werden im Politbetrieb verschwiegen“, sagt Kliche.
Kein Wunder, dass der Grünen-Politiker Volker Beck zurücktrat, als bei ihm 2016 Drogen gefunden wurden. Denn Politiker und Wähler haben eine unausgesprochene Vereinbarung geschlossen: die Politiker werden für ihre persönliche Kraft und Gesundheit gewählt – müssen dann aber auch liefern. So demonstrieren sie eiserne Belastbarkeit. „Deshalb schwamm Mao durch den Jangtse“, sagt Kliche. Politiker, die die Vereinbarung brechen, müssen meist gehen.
Anders bei körperlichen Erkrankungen. Sie werden auch bei Politikern von den Wählern inzwischen als Schicksalsschläge anerkannt. Mut, Zähigkeit und die Offenheit der Betroffenen machen den Weg frei für Empathie und die Erkenntnis: Dieser Politiker ist kein vor Gesundheit strotzender Macher, sondern ist „so verletzlich wie ich“. Das können die Wähler hinnehmen und rechnen es ihnen noch hoch an.
Starke Hand gegen Wahlstimme
Egal, ob die Haltung bei eigener Erkrankung von Politikern in „toxischer Männlichkeit“ vorgeführt wird oder in warmer Offenheit – Politiker müssen funktionieren. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen. Wenn die Vereinbarung „starke Hand gegen meine Wahlstimme“ weiter Politik machen wird, dürfte die Politik bald überfordert sein, meint Kliche.
Denn setzte sie weiter auf die Kraft und Gesundheit der einzelnen Macherinnen und Macher in der politischen Arena, so übersieht sie: Die Herausforderungen vom Klimawandel über den Populismus bis hin zur Corona-Krise sind längst viel zu groß geworden, als dass sie heldenhaft von einzelnen Kraftnaturen gestemmt werden könnten.
„Vielleicht wird der einzelne Politiker unter dem Druck der Krisen aus dem Fokus rücken und wieder stärker Argumenten und weitblickenden Konzepten Platz machen, wie wir Sicherheit und Wohlstand erhalten können“, sagt Kliche.
Die Teilhabe der Gesellschaft werde entscheidend sein für mögliche Problemlösungen – von Hygiene über Nachhaltigkeit bis zum sozialen Zusammenhalt. Kliche: „Dieser neue psychologische Vertrag mit der Politik entsteht gerade.“