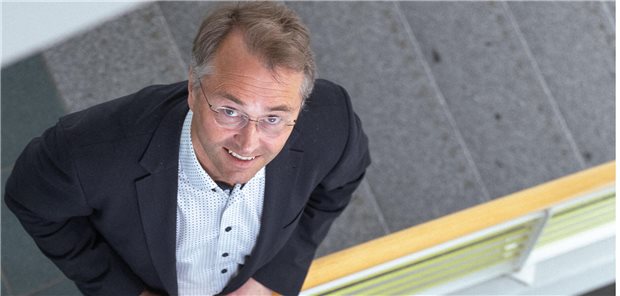EvidenzUpdate-Podcast
Mehr „Prävention“ für ein längeres Leben – wo setzen wir an?
Deutsche stürben früher. Und in manchen Regionen wären „viele Todesfälle vermeidbar“. Brauchen wir mehr Prävention? Ein EvidenzUpdate-Podcast über merkwürdige Studien, Vorbeugung und Früherkennung.
Veröffentlicht:
EvidenzUpdate mit DEGAM-Präsident Martin Scherer
© [M] sth | Scherer: Tabea Marten
In Deutschland sterben die Menschen früher als in anderen Ländern – jedenfalls im statistischen Mittel. In manchen Regionen der Republik ist vermeintlich „zu früher Tod“ sogar stärker ausgeprägt als in anderen Regionen. Und gleichzeitig gehört die Bundesrepublik weltweit zu den Spitzenreiterinnen bei den Ausgaben für Gesundheit.
Geben wir zu viel Geld für schlechte Qualität aus? Oder liegt es daran, dass wir vor allem auf Kuration setzen statt auf Prävention? Könnten wir mehr Lebensjahre herauskitzeln, wenn wir nicht nur die Prävention ausbauen, sondern vielleicht sogar die Früherkennung von Krankheiten? All diesen Fragen gehen wir in dieser Episode vom EvidenzUpdate-Podcast nach – und nehmen eine rezente Publikation auseinander. (Dauer: 35:11 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: evidenzupdate@springer.com
Quellen
- Mühlichen M, Lerch M, Sauerberg M, et al. Different health systems – Different mortality outcomes? Regional disparities in avoidable mortality across German-speaking Europe, 1992–2019. Soc Sci Med 2023;329:115976. doi:10.1016/j.socscimed.2023.115976
- Jasilionis D, Raalte AA van, Klüsener S, et al. The underwhelming German life expectancy. Eur J Epidemiol 2023;:1–12. doi:10.1007/s10654-023-00995-5
Transkript
Nößler: Gestorben wird immer, manchmal leider früher als woanders, in jedem Fall aber ist Leben das größte Risiko für den Tod. Dennoch gilt Mortalität im klinischen Vergleichen als der Endpunkt schlechthin. Manche Vergleiche aber werfen Fragen auf. Und das führt uns dann zu einem ganz anderen Thema. Über das wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zum EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler, Chefredakteur der Ärzte Zeitung aus dem Haus Springer Medizin. Moin, Herr Scherer!
Scherer: Moin, Herr Nößler.
Nößler: Wir sitzen heute hier – vielleicht hört man es am Sound, dass es ein bisschen anders ist – im Hauptstadtbüro, in der Schumannstraße in Berlin Mitte. Man darf dazusagen, es ist Dienstag, der 27. Juni. Und heute ist eine Studie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung – mal wieder muss man sagen – veröffentlicht worden. Das sind 17 Seiten, die verlinken wir in den Shownotes. Man kann es vielleicht mit einem Satz zusammenfassen. In einigen Regionen, vor allem in Norden Deutschlands wird offensichtlich früher gestorben als im Süden. Herr Scherer, was halten wir von solchen Vergleichen? Was kann man dazu sagen?
Scherer: Da muss man sich die Datengrundlage anschauen. Vielleicht – Herr Nößler, ich will Ihnen jetzt da nichts wegnehmen – schildern Sie noch einmal ganz kurz, wie die Datengrundlage beschaffen ist.
Nößler: Die Datengrundlage ist relativ einfach zusammengefasst: Die haben sich aus den statistischen Ämtern in Italien, Schweiz und Deutschland – also in Deutschland dann vom Statistischen Bundesamt – die Sterbeursachenstatistiken gezogen. Und da steht drin, in welchem Alter, mit welchem Geschlecht die Menschen in welchen Regionen, wann gestorben sind. Und in der Regel steht ein ICD-10-Code dabei oder ICD-9 oder ICD-8, je nachdem. Und dann haben sie das geclustert. Sie haben sich Menschen angeschaut, die bis einschließlich zum 74. Lebensjahr gestorben sind. Also nicht Menschen, die 90 waren. Und haben dann diese Sterbeursachen durch gesundheitliche Interventionen vermeidbare Erkrankungen aufgeteilt und in Erkrankungen, die man durch Primärprävention „verhindern“ kann. Da findet man in diesem Dokument relativ lange Listen. Da sind Infektionskrankheiten dabei, Neoplasien, Störung des endokrinen Systems, kardiovaskuläre Probleme natürlich, Atemwegserkrankung und so weiter und so fort. Das ist eine ziemlich lange Liste.
Scherer: Erlauben Sie mir noch eine Frage, bevor ich dazu was sage. Welche Kernbotschaft würden Sie als medizinischer Journalist – Pardon, als Wissenschaftsjournalist aus dieser Studie extrahieren?
Nößler: Na ja, im Prinzip fallen mir dazu auf Anhieb zwei Headlines ein. Die eine Headline könnte sein, dass die Wissenschaft feststellt, dass wir sterben. Und die zweite Headline, die mir einfällt, ist, dass die Wissenschaft feststellt, dass wir unterschiedlich sind.
Scherer: Gut. Aber es kommt ja auch der Aspekt der Vermeidbarkeit in dieser Arbeit vor. Und genau hier liegt das Problem, dass in einer riesigen Liste von Indikationen, von Conditions, von Diagnosen, Clusterungen nach Vermeidbarkeit oder nach der Möglichkeit, medizinisch einzugreifen, vorgenommen werden. Ich glaube, der Begriff dafür heißt „amenable“.
Nößler: So nennen die Autoren es auch.
Scherer: Also, hier ist schon der erste Punkt. Es ist sinnvoll, über Mortalität immer zu sprechen. Das ist einer der härtesten und etabliertesten Endpunkte. Und die zurückliegenden Jahre haben uns immer wieder natürlich auf das Problem der Übersterblichkeit aufmerksam gemacht. Wir sprechen aktuell natürlich über Hitzetote. Und jetzt kommen diese Arbeiten raus, die zeigen, dass Deutschland nicht besonders gut abschneidet in der Lebenserwartung. Jetzt muss man sich wirklich die Datengrundlage genau angucken, wenn ich mit Todesursachenstatistiken jongliere, die frei zugänglich sind, ist die Frage, welche belastbaren Botschaften man da wirklich extrahieren kann.
Nößler: Wenn man die Antwort darauf gibt – ich kann ja mal die Conclusion der Autoren dieser Arbeit vorlesen. Die schreiben hier: The efficiency of health policies in assuring timly and adequate health care and in preventing risk relevant behavior has room for improvement in all german regions, especially in the north, west and east, and an eastern Austria as well. Das ist die Conclusio der Autoren. Das sind quasi Fachleute für Demografie, muss man dazusagen, das sind keine Gesundheitsforscher. Die gucken sich Bevölkerung an, wie die sich umherverschiebt. Die interpretieren, dass man offensichtlich im Nordosten Deutschlands und im Osten Österreichs zu früh stirbt.
Scherer: Jetzt bringen die drei Sachen zusammen: die Sterbetafeln, die Todesursachenstatistik und die Regionen und sagen, da und da kann und muss oder sollte Prävention besser werden. Und das ist genau die Problematik an dieser Arbeit. Und etwas, wo ich sagen würde, so weit würde ich niemals gehen, mit solchen Daten solche Aussagen zu machen. Wir wissen nichts über die klinische Beschreibung der Stichprobe. Und von der Validität von Todesursachen noch mal ganz zu schweigen. Da wissen wir auch, dass es da Probleme gibt. Diese gängigen Kausalketten auf den Totenschein, das wäre einmal ein eigenes Thema wert, aber wir wissen, dass man da nicht immer zweifelsfrei und lückenlos diese Ketten abbilden kann. Und letztlich wissen wir über die Leute, über die da gesprochen wird, über die Leute, die bestimmte Krankheiten hatten und die dann gestorben sind, im Grunde genommen nichts. Und so weit zu gehen, dass man sagt, so und so viel Todesfälle in der und der Region wären vermeidbar gewesen. Denken Sie nur an Arzthaftungsgutachten oder an ein Gutachten der Staatsanwaltschaft. Wenn man das für einen einzigen Einzelfall tun muss, zu sagen, war dieser Todesfall jetzt vermeidbar – das ist eine tagesfüllende Arbeit, manchmal eine Arbeit von mehreren Tagen, die Akten aufzuarbeiten und zu schauen, konnte man da etwas ändern? Hätte eine bestimmte Maßnahme den Verlauf verzögert? Denn, wie Sie richtig sagen, den Tod komplett aufhalten, können wir nicht, wir können ihn nur verzögern. Aber allein das im Einzelfall zu sagen, ist sehr aufwändig.
Nößler: Sie haben den Begriff Exzessmortalität eben ins Spiel gebracht und sagen, Tod kann man nicht vermeiden. Am Ende geht es doch darum, dass man den zu frühen Tod, den mutmaßlich zu frühen Tod vermeidet. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen was zu der Übersterblichkeit sagen. Wie wird die definiert?
Scherer: Die Übersterblichkeit ist genau die Sterblichkeit, die man der erwarteten Sterblichkeit entgegenhält. Das heißt, wenn man in den vergangenen Jahren ein erwartbares Mittel an Mortalität ausmachen konnte, und man hat dann diese klassischen Peaks in der Hitzewelle oder bei bestimmten Coronawellen, dann ist es genau der Bereich über der Kurve, der sich dann abhebt und über dem Mittel bewegt, die sogenannte Übersterblichkeit, in einem Bereich, in dem man sich oberhalb der Erwartungswerte bewegt.
Nößler: Das heißt, bei der Betrachtung von Mortalität sprechen wir von Erwartungen, von irgendwelchen Vergleichen, vielleicht sogar Baseline. Und dann geht etwas hoch oder geht etwas runter. Dann ist ja die Frage: Kann es nicht auch sein, dass unsere Erwartungen vielleicht nicht die richtigen sind? Weil mit Blick auf Mortalität, dass sie irgendwann eintritt, das dürfen wir erwarten.
Scherer: Ja, auf dem individuellen Level würde ich Ihnen recht geben. Aber das ist ja genau das, was die Demografieforscher machen, sie schauen sich die Sterberaten der vergangenen Jahre an und schauen dann, was jetzt zum aktuellen Zeitpunkt darüberliegt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der einzige und der ganz wesentliche Punkt ist. Wenn wir noch einmal zurückgehen zu der Arbeit von eben, wäre ja auch die Frage: Wie kommen eigentlich die Einteilungen in vermeidbar oder beeinflussbar zustande? Sind das konsensuale, methodisch belastbare Kategorisierungen und Clusterbildungen, die da gelaufen sind? Gab es da zum Beispiel ein Panel von unterschiedlichen Stakeholdern oder Mandatsträgern, Mandatsträger von Fachgesellschaften, die dann gesagt haben, ja, die und die Erkrankung ist vermeidbar beziehungsweise beeinflussbar. Diese Todesursachen, die wären so zu diesem Zeitpunkt nicht nötig gewesen beziehungsweise hätte man es nach hinten verlegen können. Das ist alles sehr schwierig, ein sehr wackliger Bereich. Und das sind natürlich dann auch Arbeiten, mit denen man ein Paper-basiertes oder Artikel-basiertes Framing vornehmen kann. Ich will nicht von der Hand weisen, dass im Präventionsbereich einiges zu tun ist. Wir haben auch in der DEGAM von der Präventionskrise gesprochen. Aber der Weg kann nicht sein, mit Sterbetafeln und Todesursachenstatistiken auf wackligem Boden zu jonglieren und dann von da ausgehend Aussagen über eine Population zu treffen, über die man eigentlich nichts weiß.
Nößler: Bevor wir zu der vielleicht präventablen Erkrankung kommen, noch mal kurz zu den amenable causes, also die Krankheitsursachen, die man laut den Autoren – es sind übrigens tatsächlich vier Autoren, und es geht aus dem Paper nicht hervor, dass es da so ein Konsensusboard gegeben hätte. Am Ende ist es aber Peer-Review, in Social Science & Medicine publiziert. Bleiben wir noch mal bei diesen Ursachen, die die angeben, die man durch Gesundheitsversorgung beeinflussen könnte. Wie gesagt, sie reden von Menschen, die im Alter zwischen null und 74 Jahren gestorben sind, nicht die Leute, die älter waren. Und zum Beispiel geben sie hier als amenable an, Diabetes mellitus. Da ist jetzt aber nicht weiter klassifiziert, ob Typ I oder Typ II, das geht hier nicht hervor. Es gibt bakterielle Meningitiden, Epilepsie. Kann man denn, nur um diese drei einmal herauszugreifen, Herr Scherer, denn grundsätzlich sagen: Durch eine gute Gesundheitsversorgung lässt sich der Tod vor dem 75. Lebensjahr natürlich vermeiden bei diesen Erkrankungen?
Scherer: Da würde jeder Kollege, jede Kollegin mit ein bisschen Erfahrung sagen, das geht so einfach nicht. Weil das einfach ganz viele Kontextfaktoren sind, die dabei mit eine Rolle spielen.
Nößler: Noch ein bisschen krasser gefragt. Es gibt eine ziemlich lange Liste bei den Neoplasien, auch immer noch im Bereich amenable to health care, da wird zum Beispiel Leukämie angegeben.
Scherer: Sehr schwierig. Das ist eigentlich auch das, was wir versuchen zu vermeiden in der Arzt/Ärztin-Patient/Patientin-Kommunikation, dass wir dem Patienten, der Patientin die Schuld für irgendetwas geben. Diese Krebserkrankung wäre vermeidbar gewesen. Ganz schwierig, ganz problematisch. Klar, gibt es neoplasiefördernde Faktoren, das wissen wir, Rauchen ist einer der Gängigsten. Aber Vorsicht vor solchen Vereinfachungen.
Nößler: Dann sind wir direkt in der Primärprävention, wo die dasselbe gemacht haben. Da werden zum Beispiel Infektionskrankheiten angegeben, HIV ist weiten Teilen vielleicht vermeidbar, nicht ausschließlich. Hepatitiden geben sie an und sexuell übertragene Erkrankungen. Also man kann das mit dem Geschlechtsverkehr lassen, dann kriegt man auch keine sexuell übertragene Krankheit. Und dann geben sie bei Primärprävention auch – Sie sagen es, Herr Scherer – diverse Tumoren an, die damit einhergehen, Diabetes, auch hier ist nicht differenziert nach den Typen, ischämische Herzerkrankung et cetera. Auch da die Frage: Ist die Hypothese, die hinter dieser Auflistung steckt, nämlich, dass ich Krankheiten absolut vermeiden kann?
Scherer: Für die sexuell übertragbaren Erkrankungen und bei den Erkrankungen, die sich unter Umgehung des Magen-Darm-Trakts übertragen, kann man das natürlich so sagen. Völlig klar. Aber die Frage ist, ob bei einem Anstieg solcher Infektionszahlen immer gleich ein Versagen im Medizinsystem zu suchen ist oder ob es für so was immer einen Schuldigen geben muss. Wir wissen, dass man trotz guter Aufklärung - Safer Sex, gibt Aids keine Chance und so weiter – bei allem, was da getan und gemacht wird, um auf die Verhaltensebene einzuwirken, es eben dennoch Risikoverhalten gibt. Und die Frage ist, wie man dann die Zielwerte definiert. Kann das Ziel sein, null sexuell übertragbare Erkrankungen? Und noch einmal die Frage, wenn Sie dann zum Beispiel die sexuell übertragbaren Erkrankungen in ihrer Inzidenz clustern nach unterschiedlichen Regionen, was bedeutet das denn dann, wenn im Norden jetzt mehr auftreten als im Süden?
Nößler: Die Leute sind fröhlicher.
Scherer: What ever. Mehr Festivals, mehr Partys, mehr Menschen mit einer bestimmten Orientierung, die in bestimmten Regionen leben, unterschiedliche kulturelle, vielleicht auch manchmal religiöse Kontexte, in denen sich die Menschen bewegen. Also da fallen mir eine Vielzahl von unterschiedlichen Kontextfaktoren ein, die in dieser Arbeit überhaupt nicht berücksichtigt sind.
Nößler: Die man aber auch nur individuell dann herausfinden kann.
Scherer: Ganz genau.
Nößler: Kommen wir zu dem großen Thema Prävention. Die DEGAM sagt ja – ich fasse es relativ einfach zusammen –, dass wir im deutschen Gesundheitswesen auf der einen Seite relativ viel Geld ausgeben im internationalen Vergleich. Vielleicht könnte man sogar so weit gehen, dass man sagt Überfinanzierung. Und auf der anderen Seite sagt die DEGAM aber auch: Ob wir das an der richtigen Stelle ausgeben, ist zumindest mal ein kleines Fragezeichen angebracht, Stichwort Prävention. Wenn man jetzt auf der einen Seite sagt, naja, so richtig absolut ist Prävention natürlich nicht. Prävention ist eine Risikoreduktion, aber den Kollegen Zufall komplett ins Abseits stellen, kann man nicht. Wie weit muss denn Prävention gehen? Oder vielleicht ein bisschen spitzer gefragt: Kann man es mit Prävention überhaupt übertreiben?
Scherer: Ist eine interessante Frage. Ich will jetzt hier nicht mit Kalendersprüchen kommen oder mit Autoaufklebersprüchen. Aber irgendwo habe ich kürzlich gelesen, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Das betrifft uns beide. Aber ich glaube, das betrifft auch jegliche Präventionsbemühungen. Und was weiterhilft, wir suchen in diesem Gespräch nach Orientierungsmarken für so ein Thema, für das es eigentlich kaum eine Orientierungsmarke geben kann, nämlich das Sterben, die Dauer des Lebens. Was dabei oft hilft, sind Benchmarks und der Vergleich mit anderen Ländern. Und das ist auch genau der Befund, der dieses Thema zunehmend auch wieder in Gang bringt bei uns in Deutschland, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern in der Welt, in Europa auffallend schlecht liegen in der Lebenserwartung. Oder dass die Lebenserwartung in Deutschland auffallend niedrig ist, obwohl wir eines der teuersten Gesundheitssysteme der Welt haben.
Nößler: Also der Widerspruch ist da eigentlich – zugespitzt – vielleicht gar nicht, dass wir zwei, drei Jahre weniger leben im Durchschnitt, sondern der Widerspruch ist, dass unser System ineffizient ist, wenn wir so viel Geld ausgeben und trotzdem früher sterben.
Scherer: Das wäre die Hypothese, dass das Geld nicht unbedingt richtig aufgewendet wird, dass es am Bedarf vorbeigeht und dass der große Fleiß, der zweifellos da ist im Gesundheitswesen letztlich dann doch seine Wirksamkeit verfehlt.
Nößler: Die Kritik ist nun hinlänglich bekannt und auch gar nicht neu, dass wir viel für Kuration ausgeben, weniger für Prävention.
Scherer: Aber dieser Reflex, den Sie da auch in dem Paper gesehen haben, wenn irgendwo gestorben wird, dann wird schnell geschaut, war das vermeidbar und wer war dran schuld. Und wenn wir plötzlich hier nicht so gut liegen in der Lebenserwartung, dann wird meistens auch wieder so ein Reflex in Gang gesetzt, dass man an den üblichen Stellschrauben dreht, mehr Geld in die Versorgung und mehr am Detail drehen.
Nößler: Also immer noch die Leistungsmenge erhöhen, erhöhen, erhöhen. Ich versuche einmal zwei verschiedene Beispiele. Nehmen wir als erstes Beispiel: Es kommt ein Patient Mitte 40 zu Ihnen, der vielleicht jetzt nicht das absolute Idealgewicht hat und vielleicht den einen oder anderen Glimmstängel zu viel raucht. Jetzt liegt ja relativ deutlich auf der Hand, dass es da primärpräventiv durchaus Optionen gebe. Da sind wir uns ja alle einig.
Scherer: Absolut. Der wird mir dann gegenübersitzen. Ich werde den Arriba-Laptop aufklappen und dann meine Klicks machen. Hat er eine manifeste Arteriosklerose, eine positive Familienanamnese, hat er schon Bluthochdruck, wie sieht das Gesamtcholesterin aus, das HDL, liegt ein Diabetes vor. Und das Thema Rauchen. Und dann würde ich einmal bei Rauchen einen Klick machen. Dann sieht man, wie da der Balken hochgeht oder die roten Smilies mehr werden. Und einmal mache ich eben bei Rauchen den Klick weg. Aber was ich mit ihm natürlich machen werden, ist, dass ich mit ihm in das sogenannte Shared-Decision-Making reingehe. Und das ist im Grunde genommen auch die Grundhaltung der DEGAM, dass wir sagen, es ist eine individuelle Sache, wir machen Shared-Decision-Making, wir erklären den Patienten und Patientinnen die absolute Risikoreduktion und zeigen ihnen dann, dass eine bestimmte Maßnahme vielleicht dazu führt, dass bei drei von hundert sich der Erfolg einstellt. Und dann ist einfach die Frage: Ist man bereit, dafür dann lebenslang ein Statin zu nehmen zum Beispiel.
Nößler: Genau. Dann kommt nämlich der nächste Schritt, wo dann die primärpräventive Maßnahme umgesetzt werden muss. Und das in diesem Fall zunächst eigentlich von der Person und nicht von der behandelnden Person, sondern von der betroffenen Person. Und dann kommt man an den Punkt, dass man feststellt, es ist die aufwendigste Art der Intervention, weil es eine Verhaltensänderung nach sich zieht.
Scherer: Ganz genau. Die Frage ist: Gehen wir dann nicht von einer Omnipotenz des Gesundheitssystems aus? Also, versuchen wir nicht zu viel über das Gesundheitssystem zu lösen? Ist das nicht eine Hybris, würde ich fast fragen. Muss man nicht schon viel früher ansetzen in einem Bereich der Prävention, wo es die Menschen vielleicht gar nicht merken? Also stellen Sie sich vor, es gibt kein Werbeverbot mehr für Tabak, wem würde das wehtun, welchen Patienten und Patientinnen? Oder wer würde sich darüber beschweren?
Nößler: Wenn es ein Werbeverbot gäbe?
Scherer: Ja.
Nößler: Na, die Tabakindustrie, die Werbeindustrie und die Medien.
Scherer: Wir reden gerade über unsere Patientinnen und Patienten.
Nößler: Entschuldigung. Vielleicht arbeiten die dort.
Scherer: Oder noch ein anderer Punkt: Stellen Sie sich vor, wir schaffen es tatsächlich, so eine Art Zuckersteuer zu etablieren, die dazu führt, dass die ungesunden Lebensmittel teurer werden und die gesunden Lebensmittel günstiger werden. Das ist eine Art von Prävention, die merke ich überhaupt gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist, wo ist in der Prävention eigentlich die Grenze zwischen dem Zuständigkeitsbereich der GKV und dem, was man durch Weichenstellungen an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sich dann auf die Lebensweise der Menschen auswirken, bewerkstelligen kann.
Nößler: Also Prävention sollte zunächst mal nicht als Gesundheitsleistung betrachtet werden.
Scherer: Nicht zwangsläufig. Und die beste Prävention ist im Grunde genommen die, die ich nicht merke. Dadurch, dass Sportangebote attraktiver werden, dadurch dass in Schulen konsequent gesundes Essen angeboten wird, in Schulen und in Kitas, dass es auch groß angelegt unterstützt wird. Dadurch, dass Alkohol vielleicht dann doch nicht mehr so erschwinglich ist. Schauen Sie, was für harte Sachen man doch zu wirklich kleinem Geld an der Tanke bekommt. Also das sind so die Stellschreiben, die Noxen. Das Werbeverbot und die Zuckersteuer. Das sind Dinge, da könnte man ansetzen.
Nößler: Und vermutlich mit einer höheren Effizienz.
Scherer: Und sicherlich mit einer höheren Effizienz. Denn wir wissen, dass die effizienteste Verhaltensänderung immer noch die ist, die über den Geldbeutel geht. Und wenn ungesundes Verhalten teuer wird, dann wird sich da auf jeden Fall was ändern.
Nößler: Nach dem Motto ein Päckchen Zigaretten für 40 Euro.
Scherer: Ich will mich da gar nicht auf so eine Marke jetzt festlegen. Aber auch da gibt es ja noch andere Optionen. Und da kann man wiederum sagen, vielleicht kann man Raucherentwöhnungsprogramme dann doch zur Kassenleistung machen. Also diese Schnittstelle zwischen dem, was dann GKV-Zuständigkeitsbereich ist und dem, was durch politische Rahmenbedingungen gelöst werden muss, diese Schnittstelle muss man definieren. Ich denke aber auch, dass das für fingerförmig ineinandergreifen muss.
Nößler: Jetzt haben Sie natürlich ein paar Beispiele genannt. Stichwort Ernährung, Stichwort Noxen zu konsumieren. Die Beispiele sind für jeden ganz klar und zugänglich. Jetzt gibt es in der Prävention, auch in der – ich weiß gar nicht, ob man da die Grenze wirklich so scharf ziehen kann – Primärprävention auch Dinge, die vielleicht etwas unscharfer sind. Also nehmen wir mal Primärprävention in dem Sinne, dass ich ein Krankheitsrisiko reduziere, also vielleicht eine KHK: Da gibt es auch verschiedene Ursachen für, wo ich drauf eingehen kann. Das Rauchen haben Sie genannt, Fett, da gibt es ja durchaus Dinge. Aber am Ende Kollege Zufall spielt da doch überall mit. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, wir denken Prävention noch krasser, nämlich um noch mal auf meine Frage zurückzukommen: Wie krass muss Prävention sein oder können wir sie vielleicht endlos krass gestalten. Das kann uns ja im Zweifel auch in eine Vorstellung bringen, dass wir möglichst jedes Risiko frühzeitig erkennen und jedes Risiko möglichst frühzeitig minimieren wollen.
Scherer: Aber was ist ein Risiko? Sie haben zum Beispiel den Diabetes eben genannt. Ich weiß nicht, ob der Diabetes von den Autoren dieser Arbeit, die heute das Thema war, zu den avoidable oder zu den beeinflussbaren ...
Nößler: Fifty-fifty, die haben das aufgeteilt.
Scherer: Also Diabetes bedeutet nicht in jedem Fall ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Und deshalb auch hier wieder der Ansatz, dass man bei Menschen mit dem Typ-2-Diabetes das kardiovaskuläre Risiko eben kalkuliert. Und da wird dann das HbA1c – wohlgemerkt, das durchschnittliche HbA1c des zurückliegenden Jahres – verwendet und in Arriba eingegeben. Also mit anderen Worten: Vermeidbar sind die Dinge nicht unbedingt. Die Frage ist: Wie arbeitet man mit den Risikofaktoren und den Conditions. Man muss sie dann in einen integrierten Ansatz bringen. Und dann sind wir in der Versorgung. Aber die Versorgung tut sich umso leichter, je mehr im Vorfeld passiert ist. Und wir leben im Augenblick in einer Zeit, in der die grüne Lebensweise zu recht eine Bedeutung hat im Hinblick auf Klimaaspekte. Und da sprechen wir gerne von Co-Benefits. Also wenn das Radfahren umso attraktiver wird und nicht mehr zu einer Frage von Leben und Tod wie in manchen Großstädten – wenn ich zum Beispiel an meinen Arbeitsweg denke, wie ich mich da mit dem Fahrrad durch den Verkehr bewege. Also wenn es gelingt, grüne Verhaltensweisen, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen so attraktiv zu machen, dass das einfach nur noch Spaß macht, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, die Bewegungen in den Alltag zu integrieren, wenn es einfach nur noch teuer ist, sich unnachhaltig, fleischhaltig und ungesund zu ernähren und zuckerhaltig zu ernähren, wenn es einfach nur noch teuer ist. Wenn solche Weichenstellungen im Vorfeld passieren, tut sich die Medizin natürlich leichter. Die Frage ist immer: Wie krass muss es sein?
Nößler: Das war meine Frage.
Scherer: Und da habe ich als Arzt natürlich leicht Reden. Aber das muss ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess sein. Und es muss konsensual und demokratisch dann natürlich ablaufen.
Nößler: Lassen Sie es uns doch schrittweise und diskret versuchen. Wir machen Ja/Nein, stimme zu/stimme nicht zu. Würden Sie zustimmen, Herr Scherer, dass die U- und J-Untersuchungen klug sind?
Scherer: Ja.
Nößler: Auch um Risiken zu erkennen?
Scherer: Ja.
Nößler: Würden Sie zustimmen, dass die Schuleingangsuntersuchungen klug sind, um den Gesundheitsstatus eines Kindes zu erkennen?
Scherer: Grundsätzlich ja. Kommt drauf an, wie es abläuft.
Nößler: Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Das ist jetzt eine Suggestivfrage, tut mir leid. Würden Sie zustimmen, dass das Hautkrebsscreening sinnvoll ist?
Scherer: Als opportunistisches Screening – ja. Also Bevölkerungs-Gießkannenverfahren – nein.
Nößler: PSA-Testung für alle Männer?
Scherer: Als isoliertes Laborexperiment – nein.
Nößler: Also auch da wieder Stichwort Vortest-Wahrscheinlichkeiten.
Scherer: Ja.
Nößler: Das war jetzt vielleicht eine merkwürdige Mischung so an verschiedenen Dingen. Aber es eint ja alle, dass wir Gewissheiten suchen, sowohl als potenziell Betroffene, vielleicht sogar auch im Gesundheitssystem Handelnde, Behandelnde. Dass wir Ungewissheiten versuchen zu reduzieren. In der Hoffnung, wenn ich Gewissheit über einen Zustand habe oder über ein Risiko, dass ich dann frühzeitig reingehen kann. Würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, dass es klug ist. Und wir sprechen im Podcast oft über den Nutzen, Sinn und Unsinn von Screenings, populationsbreit. Wo ziehen wir denn die Grenze? Kann man das generalisieren im Bereich Früherkennung/Prävention? Früherkennung ist ja ein Teil davon.
Scherer: Wir müssen uns natürlich über die Begriffe verständigen. Uns auch immer klarmachen, in welchem Bereich wir uns bewegen. Wenn wir zum Beispiel über die DMPs sprachen, dann sind wir schon ziemlich tief drin im Bereich der Tertiärprävention eigentlich. Und viele auch aus den medizinischen Fachdisziplinen, wenn die Kolleginnen und Kollegen dann über Prävention sprechen, meinen sie eigentlich Früherkennung. Und das ist genau diese Differenzierung, die wir eigentlich machen müssen.
Nößler: Tertiärprävention – ich habe ein Ereignis gehabt, nehmen wir wieder die 40-jährige Person, die einen besonderen BMI hat, eine Zigarette zu viel raucht, und die hat ein Ereignis gehabt, da wird ja jeder zustimmen, dass man da was macht, oder? Im Zweifel mit einem Statin reingeht.
Scherer: Zweifellos. Ja.
Nößler: Noch mal retour zu demjenigen, wo noch keine Krankheitslast ist. Jetzt kommt die Quartärprävention, glaube ich, ist es. Die Grenze kann ja beliebig verschoben werden. Also ich will jetzt mal keine Namen nennen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es Interessen geben könnte mit Prävention im weitesten Sinne. Oder vielleicht auch mit Früherkennung vielleicht sogar ein Geschäft zu machen.
Scherer: Das Thema hatten wir schon oft. Also da reden wir dann über Grenzwerte bei der Lipidbestimmung oder bei der Hypertonie. Und das ist eben mein Plädoyer, da aufzupassen, die Medizin nicht zu überschätzen, klar zu definieren, was ist Aufgabe der Versorgung, wo ist dann der ärztliche Zuständigkeitsbereich, wo reden wir über Pharmakologie und wo über nicht-medikamentöse Therapiemaßnahmen. Und was muss eigentlich außerhalb der Praxis passieren. Und das ist eine Hybris anzunehmen, dass wir in unseren Praxen in Deutschland Dinge heilen können, die außerhalb der Praxen schiefläuft. Und das ist aber auch ein gängiger Reflex. Und da sind wir wieder beim Beginn dieser Arbeit. Und da schließt sich der Kreis. Da werden Todesursachen hochgezählt, Sterbetafeln verglichen und dann passiert der Reflex. Im Bereich der Früherkennung sind wir nicht gut genug. Und die Medizin braucht mehr Ressourcen und wir müssen diese und jene Tablette früher geben. Wenn es mal so einfach wäre.
Nößler: Wenn es mal so einfach wäre. Das ist das Schlusswort und das ist im Prinzip der Leserbrief auf diese Publikation hier im O-Ton gewesen, dass es eben nicht zwingend nur eine Frage der Gesundheitspolitik ist, da zu intervenieren und man eben auch, wenn ich Sie richtig verstehe, fragen muss, welche Grenze wollen wir wirklich ziehen.
Scherer: Ganz genau.
Nößler: Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
Scherer: Ich danke Ihnen, dass ich hier im Hauptstadtstudio live in ein schwarzes Puschelmikrofon sprechen durfte.
Nößler: Das auch bestimmt gereinigt wird danach. Ahoi.
Scherer: Tschüss.