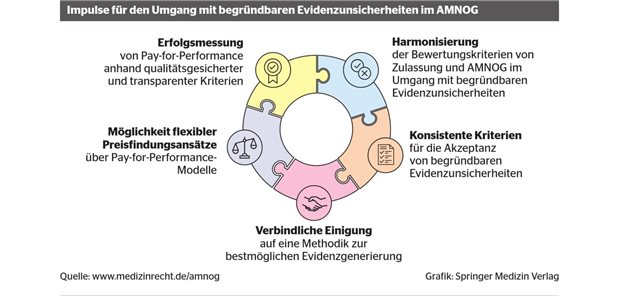AMNOG
Zahlen und Fakten zur frühen Nutzenbewertung
Wie beeinflusst die Nutzenbewertung die Preise? Es kommt nicht allein auf das Ausmaß des Zusatznutzens an, auch der erwartete Umsatz spielt eine Rolle.
Veröffentlicht:Berlin. Seit Jahren analysiert Dr. Julian Witte, Gesundheitsökonom an der Uni Bielefeld die AMNOG-Effekte. Sein Fazit.
- Die Art der Verfahren ändert sich, Erstbewertungen nehmen kontinuierlich ab, erneute Bewertungen aufgrund befristeter Beschlüsse, neuer Erkenntnisse und neuer Anwendungsgebiete steigt. Dabei wächst die Zahl der bewerteten Fragestellungen. Die einst ausgeprägte Neigung des Bundesausschusses zur Bildung von Teilpopulationen ist allerdings rückläufig.
- Der Anteil der Verfahren, die mit der Anerkennung eines Zusatznutzens abschließen, liegt in etwa konstant bei 60 Prozent, variiert aber je nach Indikationsgebiet und ist in der Onkologie fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt. Je kleiner die Zielpopulation, desto höher fällt der Zusatznutzen aus.
- Die Unsicherheit beim Bewertungsverfahren ist beträchtlich. In 80 Prozent der Verfahren ist die Datenlage nicht vollständig. Das führt dazu, dass in zwei Drittel der Verfahren die Evidenzlage nicht erlaubt, einen Beleg für einen Zusatznutzen anzuerkennen, sondern nur einen Hinweis oder Anhaltspunkt. Dies führt in einem Fünftel der Beschlüsse zu deren Befristung. Häufig unsicher ist auch die Schätzung der Zielpopulationen – wichtig für die Kalkulation des Budget-Impacts.
- Der Erstattungsbetrag und damit der Rabatt auf den Markteintrittspreis ist nicht allein vom Ausmaß des Zusatznutzens und der Evidenzlage abhängig. Festgestellt wurden auch folgende Zusammenhänge: Je höher der Markteintrittspreis, desto stärker der Abschlag. Je größer die Zielpopulation, desto niedriger der Erstattungsbetrag. Bei der Höhe der Jahrestherapiekosten ist eine Budgetsensitivität für die Kassen wahrscheinlich. Die ausgehandelten Rabatte variieren zwischen 19 und 28 Prozent.
- Effekte auf die Versorgung und das Verordnungsverhalten der Ärzte durch die Ergebnisse der Nutzenbewertung sind schwer zu isolieren und kausal zuzuordnen. Die Datenlage dazu ist unzureichend.