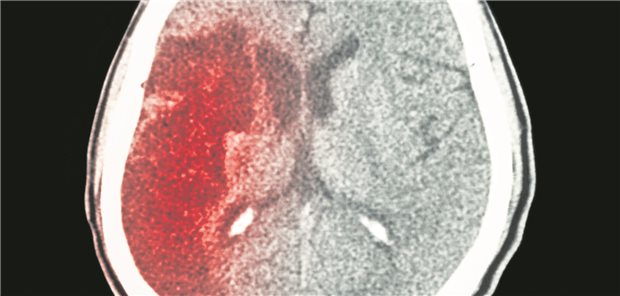Verfassungsklage ohne Erfolg
Gericht untersagt Brandenburger Volksinitiative „Gesundheit ist keine Ware“
26.000 Menschen hatten sich in Brandenburg der Volksinitiative „Gesundheit ist keine Ware“ angeschlossen - mit dem Ziel, die ärztliche Versorgung zu stärken. Die Richter erteilten dem Projekt nun eine Absage.
Veröffentlicht:Potsdam. Brandenburgs Landesverfassungsgericht hat die von 26.000 Menschen unterzeichnete Volksinitiative „Gesundheit ist keine Ware. Krankenhäuser und Praxen retten“ für unzulässig erklärt.
Die Initiative sei nicht hinreichend klar und bestimmt gewesen und verstoße gegen das so genannte Koppelungsverbot, sagte Gerichtspräsident Markus Möller am Freitag in Potsdam. „Für einen objektiven Betrachter muss klar sein, worüber er abstimmt, was Zielrichtung der Befassung ist und welche Folgen die Abstimmung hat.“
Die von 26.000 Brandenburgern unterschriebene Initiative hatte das Ziel, alle Krankenhausstandorte im Land zu erhalten, die Investitionszuschüsse für Kliniken zu erhöhen und die Ansiedlung von Ärzten zu fördern. Das Brandenburger Landärztestipendium sollte ausgeweitet und die Kosten für die Ausbildung zur „Praxisschwester“ übernommen werden.
Stärkung der medizinischen Versorgung
Der Parlamentarische Beratungsdienst des Landtags hatte der Initiative jedoch in einem Gutachten vorgeworfen, Forderungen zu bündeln, die „auf unterschiedlichen rechtlichen Grundlagen beruhen, kein klar definiertes Rechtsgebiet bilden, sowie jeweils getrennt zur Abstimmung gestellt und Inhalt je eigenständiger Gesetze werden könnten.“
Daraufhin wurde die Initiative vom Hauptausschuss des Landtags für unzulässig erklärt. Dagegen wehrten sich die Freien Wähler mit der Klage vor dem Verfassungsgericht.
In der Verhandlung am Vormittag hatte der Vertreter der Freien Wähler, der Potsdamer Verfassungsrechtler Prof. Thorsten Ingo Schmidt erklärt, die Einzelpunkte der Initiative richteten sich alle auf dasselbe Ziel: Eine Stärkung der medizinischen Versorgung im ländlichen Bereich.
Der Vertreter des Landtags, Münchner Verfassungsjurist Prof. Stefan Korioth, sah das anders: „Es gehört aber zwingend zum demokratischen Prinzip, ein solches Koppelungsverbot zu haben.“
Warnung vor „Wildwuchs“
Er warnte vor einem „Wildwuchs“ von Volksinitiativen. Man müsse es den Bürgern überlassen wollen, ob sie bei zwei oder drei Themen zwei oder drei Unterschriften geben wollen. „Das erhöht die Mitwirkungsmöglichkeiten des einzelnen Bürgers ganz erheblich.“
Dem schloss sich das Gericht an: Wie Möller in der mündlich vorgetragenen Begründung ausführte, wiesen die vier Teilanliegen der Volksinitiative nicht den nötigen inhaltlichen Zusammenhang aus. Jedes der Teilanliegen könnte auch für sich eine Volksinitiative bilden. „Bedenken, dass sich aus dem Koppelungsverbot eine zu weite Einschränkung der direkten Demokratie ergebe, greifen nicht“, sagte Möller. (lass)