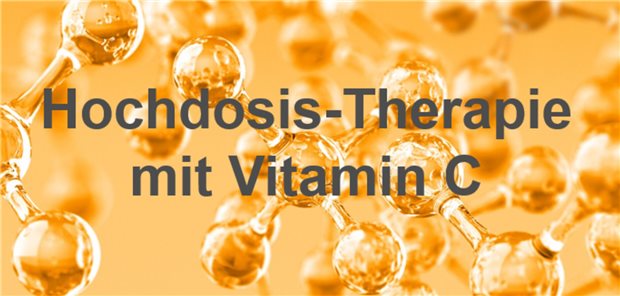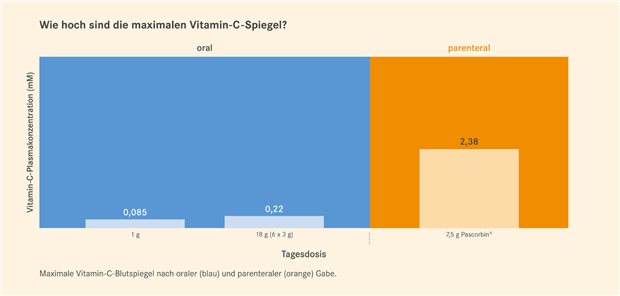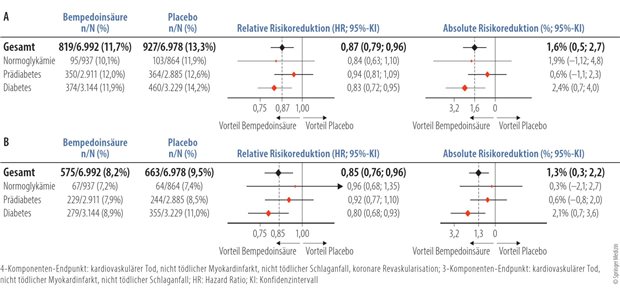Ein "alter Hase" erzählt
Reise in die Vergangenheit: Ein ungewöhnlicher Selbstversuch
Klinik statt Praxis, junger Arzt statt "Alter Hase": In einem Selbstversuch hat der niedergelassene Internist Ivo Grebe die Perspektive getauscht. Exklusiv für die "Ärzte Zeitung" erzählt der 64-Jährige, wie er seine fünftägige Hospitanz erlebt hat – und was sich seit seiner Weiterbildungszeit alles geändert hat.
Veröffentlicht:
Visite, Besprechung mit Kollegen, Bürokratie: Der Klinikalltag ist vielfältig – und die Digitalisierung hält oft erst zögerlich Einzug.
© elenab
Der erste Tag beginnt mit einer Überraschung. Statt der erwarteten Morgenbesprechung treffen sich alle ärztlichen Mitarbeiter um 8 Uhr zu einer kleinen Präsentation mit anschließender Diskussion zum Thema "Akute Galle". Die Referentin ist eine Assistentin im letzten Weiterbildungsjahr Innere Medizin. Kurze Diskussion, dann werden die Neuankömmlinge vom Chef vorgestellt: eine junge Kollegin, die die letzten sechs Monate ihrer allgemeinmedizinischen Weiterbildung ableisten möchte, eine Kollegin, die aus einem anderen Haus wechselt. Es stimmt also: Die Medizin wird weiblich.
Dr. Ivo Grebes Selbstversuch
Der "alte Hase": Jahrgang 1953, niedergelassener Internist in hausärztlicher Tätigkeit, berufsausübende Kooperation mit einem Schwerpunkt-Internisten seit mehr als 25 Jahren, Krankenhaustätigkeit bis 1989.
Der Selbstversuch: Dr. Ivo Grebe hat sich Jahrzehnte nach seiner eigenen Weiterbildung fünf Tage lang für eine Hospitation in der Klinik entschieden (April 2017) – um zu sehen, wie er die Situation junger Assistenzärzte aus erfahrener Sicht bewertet.
Ort des Geschehens: ein Krankenhaus mittlerer Größe; speziell: die Abteilung Innere Medizin mit 140 Betten, einem Chefarzt, 7,5 Oberärzten und 24 Vollzeit-Assistenten
Dann geht es auf die Station, ein netter Kollege nimmt mich mit zur Visite auf die "Monitorstation" – heute nennt man diese "IC", "Intermediate care". Die meisten Patienten liegen am Monitor, zentral verschaltet mit dem Pflegearbeitsplatz. Über das Wochenende sieben Neuaufnahmen, die Bettenkapazität ist erschöpft.
Bei der Visite geht alles sehr schnell, zwei bis drei Sätze pro Patient, keine Untersuchung, allenfalls mal eine kurze Auskultation der Lunge, dann werden Untersuchungen angesetzt: Labor, Röntgen, CT, Gastroskopie. Bemerkenswert anders: Die Visite wird vom Stationsarzt allein durchgeführt, manchmal begleitet von Famulus oder PJler, keine Krankenschwester, kein Hilfspersonal.
Das Tempo überrascht – dank PC
Geschrieben und notiert wird auf Papier, Blutdruck, Puls, Temperatur in Kurvenform per Hand eingezeichnet. Die Kurvenmappe liegt dem Visitenwagen auf, darunter befinden sich in einer großen Schublade die einzelnen Krankenakten mit Vorbefunden, alles in Papierform. Der Stationsarzt spricht mit den Patienten, sucht alte Befunde raus, diskutiert mit mir den ein oder anderen Fall, geht zwischendurch ans Telefon, rennt dann wieder ins Arztzimmer, um am PC die aktuellen Laborwerte nachzusehen. Es wirkt alles sehr unsystematisch, fast wuselig, doch am Ende heißt es ganz deutlich: Patient aus Zimmer 312 wird verlegt, Patientin in 309 kommt auf die Intensivstation, der Patient von 308 braucht noch ein Thorax-CT.
Das Tolle ist: Kaum ist die Visite zu Ende, schon liegt der Röntgenbefund vor, und zwar digital auf dem PC-Bildschirm, schon ist das Labor eingelesen, können die Werte von heute früh durchgescannt werden. Das Tempo überrascht sehr, davon können wir in der Praxis nur träumen.
Nach verschiedenen Routineaufgaben – Aufklärungsgespräche mit Patienten, Telefonate, Anrufe aus der Ambulanz – und der Mittagspause in der Kantine geht es wenige Flure weiter zur Röntgenbesprechung. Uns "alten Hasen" noch bekannt als Ansammlung großformatiger Röntgenfilme, aufgehängt vor einem noch größeren Lichtkasten, an dem seitlich stehend der Oberarzt der Radiologie mit Teleskopstock die Ulcera duodeni in der Magen-Darm-Passage demonstriert, während die internistischen Assistenten und Oberärzte gelangweilt gähnen – wissend, dass endoskopischer Befund und radiologische Bildgebung nur wenige gemeinsame Schnittpunkte haben. Ganz anders heute: Da sitzt der Radiologe vor dem Laptop mit angeschlossenen Beamer und scrollt die CT-Bilder in einem Tempo durch, dass einem fast schwindelig wird. Im kurzen kollegialen Wortwechsel spürt man das Bemühen beider Seiten, klinische Angaben und radiologischen Befund zu korrelieren, was in den meisten Fällen auch gelingt.
Es bleibt noch Zeit für einen kurzen Ausflug in die Zentralhöhle der Abteilung, die Endoskopie. Es herrscht ein lockeres Klima, wie überall im Haus: Ich treffe eine flache Hierarchie, das "Du" zwischen Endoskopie-Personal und Oberärzten ist häufig. Die Arbeit wird routiniert, ruhig und sehr sicher erledigt, von allen Seiten. Kein Stress, kein lautes Wort, freundlicher Ton – und das bei über 10.000 Eingriffen jährlich.
Chef ist sich fürs Faxen nicht zu schade
Befunde werden nach der Endoskopie von Ärzten – in der Tat gibt es hier deutlich mehr männliche Ärzte – selbst in den PC geschrieben, notfalls auch sofort ausgedruckt und dem Patienten mitgegeben. Der Chef ist sich nicht zu schade, den gerade erhobenen Befund eines Forrest IIA-Ulcus selbst auf das Fax zu legen und die Nummer des überweisenden Kollegen einzugeben – zack, schon hat dieser den Endoskopie-Bericht seines Patienten auf dem Schreibtisch.
Pünktlich um 15.30 Uhr beginnt die Assistentenbesprechung, der Chef und die meisten Oberärzte sind anwesend. Alle Stationen werden für den Spät- oder Nachtdienst gescreent nach schwierigen Fällen. Neuaufnahmen oder Problempatienten werden kurz vorgestellt, zwei intensivpflichtige Patienten sind in kritischem Zustand. Einmal in der Woche gibt es das interne Fehlermanagement: Jeder darf berichten, wo und wie etwas falsch gelaufen ist und wie Verbesserungen aussehen könnten. Zum Beispiel kommen in der Notaufnahme unangemeldet bettlägerige Patienten an mit einer Einweisung zur PEG-Anlage – es fehlt an vorheriger Absprache mit dem Heim oder dem behandelnden Arzt. Nach 20 Minuten ist die Versammlung vorbei, jeder geht auf seine Station. Dort warten Angehörige auf eine Auskunft, Krankenpfleger oder -schwestern wollen einige Unterschriften, eine Infusion muss neu angelegt werden und im Arztzimmer stapeln sich neue Befunde oder die Krankenakten für die Entlassungsberichte. Dafür bleibt nicht mehr viel Zeit an diesem Tag, die Briefe müssen warten. Der Hausarzt wundert sich dann, warum die Arztbriefe erst so spät ankommen…
Mit welchen Eindrücken geht der "alte Hase" nach Hause? Insgesamt bleibt ein positives Bild. Ja, die Arbeitsabläufe sind verdichtet, es bleibt wenig Zeit für Gespräche oder Gedanken außerhalb des durchgetakteten Tagesablaufs, aber die Arbeitsatmosphäre ist insgesamt gut. Unter den Assistenten – zwei Drittel von ihnen sind weiblich – herrscht ein sehr kollegiales Klima, Diensttausche gelingen meist problemlos, für Rotation ist gesorgt. Bei Wunsch nach Sonderurlaub etwa unmittelbar vor der Facharztprüfung springen die Anderen ein, um den Kandidaten bis zum Termin von zusätzlichen Aufgaben zu entlasten. Das stärkt das Wir-Gefühl.
Ökonomischer Druck ist spürbar
Dennoch ist beim Blick hinter die Kulissen der ökonomische Druck überall spürbar. Kein Patient liegt auch nur einen Tag länger auf Station als nötig, bei multimorbiden Patienten ist die Suche nach adäquater poststationärer Versorgung in einem vernünftigen Zeitfenster manchmal sehr nervenaufreibend. Diagnostik, die von außen eingekauft werden muss, wie Speziallabor, Facharzt-Konsile oder spezifische radiologische Verfahren, werden äußerst sparsam eingesetzt. Therapeutische Entscheidungen werden gebahnt, für die Beobachtung des Erfolges bleibt im stationären Bereich keine Zeit – der Patient steht nach fünf Tagen Krankenhausbehandlung in der Praxis und fragt nach der richtigen Medikation. Vielleicht ein Problem, das mit dem neuen Entlassmanagement ab Oktober deutlich verbessert werden kann?
Und die Digitalisierung? Das war die größte Überraschung: Sie ist längst nicht so fortgeschritten wie gedacht. Elektronische Krankenakte? Fehlanzeige. Vernetzung mit anderen Abteilungen? Nein. Elektronischer Arztbrief? Noch keine Überlegung. Insgesamt sind viele kleine Fortschritte erkennbar: Speicherung der Endoskopie-Befunde, im gesamten Bereich der Bildgebung und Radiologie. Aber bei den Basics – Krankenblatt, Dokumentation, Routineaufgaben – dominiert nach wie vor die analoge Technik, die handschriftliche Aufzeichnung. Das führt bisweilen zu einem geordneten Chaos von digitaler und analoger Dokumentation bei ein- und demselben Patienten, was die Arbeit nicht leichter macht. Fazit: Es ist noch viel Luft nach oben. (jk)