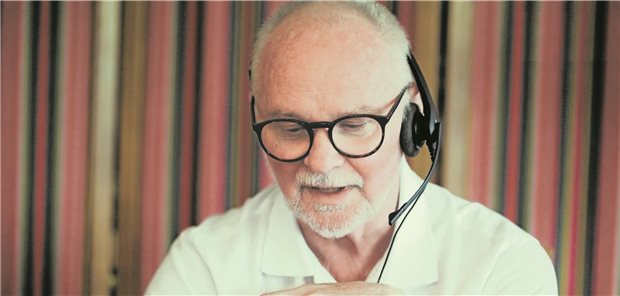Schlummerndes Potenzial bei Telemedizin
Deutschland droht ein herber Rückschlag in der Telemedizin. Es hapert an der Umsetzung - Ärzte stehen der Telemedizin aber grundsätzlich positiv gegenüber.
Veröffentlicht:
Telemedizin, wie etwa die regelmäßige Blutdruckkontrolle von zu Hause, ermöglicht es Patienten, länger selbstständig zu leben.
© bilderbox/fotolia.com
KÖLN. In der Telemedizin läuft Deutschland Gefahr, international den Anschluss zu verlieren, warnt der Gesundheitsökonom Dr. Josef Hilbert. Der Grund: Während es eine rührige Forschungslandschaft gibt, hapert es - im Unterschied zu vielen anderen Ländern - an der Umsetzung.
"Wir haben bei Forschung und Entwicklung rechtzeitig angefangen, werden jetzt aber überholt", sagte der Direktor des Instituts Arbeit und Technik auf dem "Gesundheitskongress des Westens 2012" in Köln.
In Deutschland gebe es rund 270 registrierte Initiativen und Projekte auf dem Gebiet der Telemedizin. "Wenn man es großzügig sieht, sind 100 in irgendeiner Form in den Regelbetrieb gelangt", sagte er.
Bislang sei die Kardiologie bei den Anwendungen die Königsdisziplin, gefolgt von den Bereichen Homecare und Pflege.
Patienten sind entscheidende Treiber für Entwicklung
Ein Problem sieht Hilbert darin, dass die Telemedizin häufig von technologiegetriebenen Leuten vorangebracht werde, die blind gegenüber der Kompetenz, den Interessen und der Tradition von Patienten, Ärzten und Pflegepersonal seien.
"Wir müssen in Forschung und Entwicklung ganzheitlicher denken", forderte er. Die medizinische Wirksamkeit müsse ebenso in den Blick genommen werden wie die soziale Akzeptanz, die wirtschaftliche Effizienz und die betriebswirtschaftliche Umsetzbarkeit.
Die Patienten werden der entscheidende Treiber für die Entwicklung sein, weil sie telemedizinische Anwendungen aktiv einfordern, erwartet der Gesundheitsökonom. Er hält eine Öffentlichkeits- und Informationskampagne für notwendig, um auf die Möglichkeiten und Vorteile der Telemedizin hinzuweisen. "Da ist die Branche gefordert, so etwas wie ein Gemeinschafts-Marketing aufzubringen."
Nach Einschätzung des Kardiologen Professor Christian Zugck von der Universitätsklinik Heidelberg muss die wissenschaftliche Begleitung telemedizinischer Anwendungen eine größere Rolle spielen.
"Wir brauchen die offene und kontinuierliche Evaluation existierender Projekte." Sinnvoll sei dabei die Kooperation mit den Krankenversicherungen.
Randomisierte kontrollierte Studien nicht Mittel der Wahl
Außerdem sei ein langer Atem notwendig, die Evaluation dürfe nicht zu kurzfristig sein, sagte Zugck. "Viele telemedizinische Projekte zeigen erst nach 36 Monaten Wirkung."
Für die Bewertung telemedizinischer Verfahren seien randomisierte kontrollierte Studien nicht das Mittel der Wahl, sagte Professor Benno Neukirch von der Hochschule Niederrhein.
"Wir brauchen die Evaluation unter den Bedingungen der Regelversorgung, nicht unter Studienbedingungen." Basis seien Routinedaten.
Für notwendig hält Neukirch die risikoadjustierte Bestimmung des Outcome und der Kosten über einen Zeitraum von einem Jahr bis fünf Jahren.
"Die datenbasierte Evaluation kann man mit deutlich weniger Aufwand machen als eine randomisierte klinische Studie."
In der Ärzteschaft gebe es grundsätzlich eine breite Zustimmung zur Telemedizin, betonte der Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein Dr. Franz-Josef Bartmann. Das liege vor allem daran, dass es sich um ein Bottom-up-System handele.
"Der Impuls kommt aus der Medizin", sagte Bartmann. Das unterscheide die Telemedizin von der elektronischen Gesundheitskarte. Allerdings seien nicht alle Ärzte, die den Anwendungen positiv gegenüber stehen, auch bereit, sie selbst einzusetzen.
Vorteile der Telemedizin sind Ärzten noch nicht so bekannt
Nach Einschätzung von Bartmann müssen auch in der Ärzteschaft die Vorteile der neuen technischen Anwendungen für die Patientenversorgung - etwa durch telemedizinische Konsiliare - noch bekannter werden.
Um die Krankenkassen mit ins Boot zu holen, sei es wichtig, dass die Systeme bisherige Leistungen ersetzen und nicht noch zusätzlich zu ihnen kommen, sagte er.
Zudem müssten die Projekte eine gewisse Größe haben. "Wenn wir in einer großen Region substitutive Systeme einsetzen, die tatsächlich Geld sparen, werden die Krankenkassen die ersten sein, die 'hier‘ schreien."