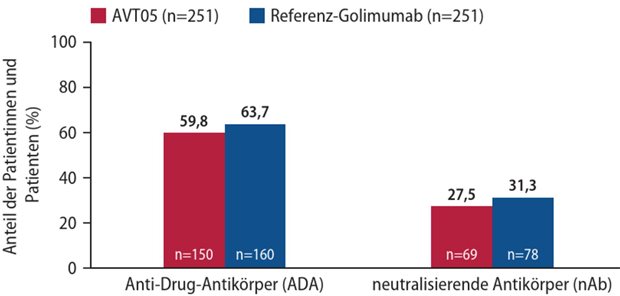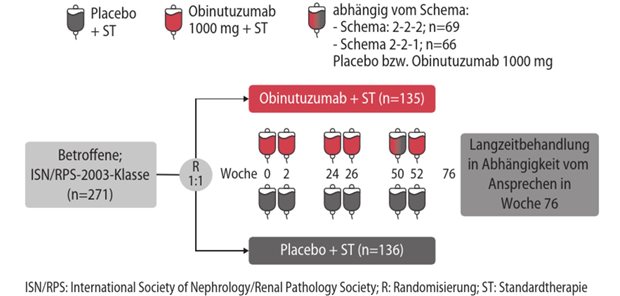Atypische Antipsychotika gewinnen an Bedeutung
MÜNCHEN (wst). Bipolare Störungen beginnen meist bereits in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter. Um akute manische Episoden in den Griff zu bekommen und das Risiko manischer Rezidive zu vermindern, gewinnen atypische Antipsychotika an Bedeutung.
Veröffentlicht:Bei einigen Patienten mit bipolarer Störung kommt es nur zu einer einzigen Krankheitsepisode. Weitaus häufiger verläuft die Krankheit aber rezidivierend, wobei zwischen den Episoden oft keine vollständige Genesung eintritt. Darauf hat Professor Michael Bauer aus Dresden hingewiesen.
Angesichts des hohen Leidensdruckes und der hohen Begleitrisiken sei es um so bedauerlicher, dass viele bipolare Erkrankungen nicht oder erst mit erheblicher Verzögerung korrekt diagnostiziert werden, so der Experte auf einer Veranstaltung der Unternehmen Bristol-Myers Squibb und Otsuka in München. Nach Daten einer 2003 veröffentlichten großen Reihen-Untersuchung aus den USA mit 125 000 Erwachsenen waren 3,7 Prozent bipolar erkrankt, von diesen hatten jedoch nur 20 Prozent die richtige Diagnose.
Sind bei rein depressiven Episoden moderne Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Mittel der Wahl, gewinnen bei manischen Episoden atypische Antipsychotika an Gewicht. Gemäß den frisch überarbeiteten britischen NICE-Leitlinien sollte bei bislang unbehandelten Patienten mit bipolarer Störung gegen schwere manische Episoden primär ein atypisches Antipsychotikum verabreicht werden, sagte Bauer. Ist damit in der üblichen Dosierung keine ausreichende Linderung zu erreichen, sollte zusätzlich mit Stimmungsstabilisatoren wie Lithium oder Valproat therapiert werden. Umgekehrt sollte nach den NICE-Leitlinien bei mit Lithium oder Valproat wenig erfolgreich behandelten Patienten versucht werden, mit einem modernen Antipsychotikum zu behandeln.
Neu zugelassen bei Patienten mit manischen Phasen bei einer Bipolar-I-Störung ist seit kurzem Aripiprazol (Abilify®). In Studien blieben mit dem atypischen Antipsychotikum innerhalb von zwei Jahren 80 Prozent der Patienten rezidivfrei, mit Placebo nur 50 Prozent.
STICHWORT
Bipolare Störung
Die bipolare Störung ist ähnlich häufig wie Schizophrenie, aber seltener als eine unipolare Depression. Nahezu vier Prozent der Erwachsenen haben manisch-depressive Phasen. Bipolare Störungen sind zudem von allen psychischen Erkrankungen mit dem höchsten Suizidrisiko behaftet. Ein Drittel aller Betroffenen unternimmt mindestens einen Suizidversuch, und 15 Prozent aller schwer Erkrankten bringen sich tatsächlich um. Frühberentung ist die Regel, und die meisten Betroffenen haben schon bis zum 40. Lebensjahr ihren beruflichen Werdegang beendet. Auch ist unter bipolar erkrankten Patienten mit einer Häufigkeit von 30 bis 40 Prozent Alkohol- und Drogenabusus überdurchschnittlich weit verbreitet. Die Komorbidität mit Angststörungen wird in der wissenschaftlichen Literatur mit 20 bis 40 Prozent beschrieben.
(wst)