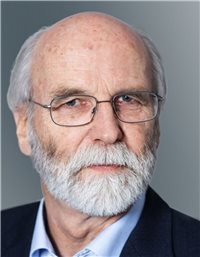HINTERGRUND
Bei der Erforschung des Klonens müssen die britischen Wissenschaftler eine Menge Hürden überwinden
Jegliches Klonen - reproduktives wie therapeutisches - ist in Deutschland verboten. Ganz anders in England: Im Jahr 2001 trat dort ein Gesetz in Kraft, demzufolge "das Einpflanzen eines menschlichen Embryos in den Uterus, der nicht durch natürliche oder künstliche Befruchtung entstanden ist, verboten ist". Damit ist therapeutisches Klonen, von manchen Wissenschaftler eher als Forschungsklonen bezeichnet, in Großbritannien erlaubt.
Jetzt ist auch der erste Antrag - gestellt von Forschern in Newcastle - von der HFEA (UK Human Fertilization & Embryology Authority) genehmigt worden. Was haben die britischen Wissenschaftler vor?
Dr. Miodrag Stojkovic von der Universität von Newcastle will mit seinen Kollegen vom Institut für Humangenetik und vom Life-Fertility-Zentrum den Kern einer Patienten-Hautzelle in eine entkernte Eizelle einer Frau schleusen und dann die Embryonalentwicklung anstoßen.
Das Zytoplasma des Eis reprogrammiert der Theorie nach das Genom des eingeschleusten Zellkerns, indem die Gene der erwachsenen Zelle ab- und Gene für die Embryonalentwicklung angeschaltet werden. Die britischen Forscher planen, Dutzende solcher Embryonen zu klonen. Aus der inneren Zellmasse der sich entwickelnden Blastozysten wollen die Forscher dann jeweils embryonale Stammzellen isolieren.
Im großen und ganzen nutzen Stojkovic und seine Kollegen das Verfahren, mit dem auch das Klonschaf Dolly vor wenigen Jahren geschaffen wurde. Ziel dieses Forschungsklonens ist, schließlich aus den embryonalen Stammzellen insulinproduzierende Zellen zu züchten, mit denen jene diabetischen Patienten, denen jeweils der Kern einer Körperzelle entnommen worden war, behandelt werden sollen. Die Patienten bekämen eigenes Gewebe implantiert, das nicht abgestoßen wird, so die Hoffnung der Forscher. Mit adulten Stammzellen ließe sich wegen der eingeschränkten Verwandlungsfähigkeit das Vorhaben nicht realisieren.
So einfach, wie das Vorhaben klingt, ist es allerdings wahrscheinlich nicht. Denn der erste Versuch, menschliche embryonale Stammzellen durch Klonen herzustellen - im März von südkoreanischen und US-Forschern veröffentlicht -, erforderte für eine einzige geklonte embryonale menschliche Stammzelle insgesamt 242 Eizellen von 16 Spenderinnen.
Im nächsten Schritt kann es ebenfalls Schwierigkeiten geben: Die Forscher müssen herausfinden, wie sie in der Kulturschale verläßlich die geklonten embryonalen Stammzellen in das gewünschte Gewebe, etwa Beta-Zellen des Pankreas oder bestimmte Neuronen, verwandeln können. Zudem muß ausgeschlossen werden, daß sich das entstandene Gewebe in Tumoren entwickelt.
Nicht zuletzt die Quelle für die Eizellen muß geklärt werden. Stojkovic will Eizellen verwenden, die im Zusammenhang mit einer In-vitro-Fertilisation übrigbleiben und von den Frauen gespendet werden.
Stojkovic ist nicht der einzige Wissenschaftler in Großbritannien, der das Forschungsklonen vorantreiben will. Auch Dr. Ian Wilmut, der das Schaf Dolly geschaffen hatte, will einen Antrag für therapeutisches Klonen stellen. Wilmut plant, Zellen von Patienten mit amyotropher Lateralsklerose zu klonen, um mit den gezüchteten embryonalen Stammzellen Gewebe zum Ersatz von Motorneuronen zu züchten. Und auch der japanische Wissenschaftsrat hat sich jetzt für das Forschungsklonen ausgesprochen.
Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Eine Grenze ist erreicht