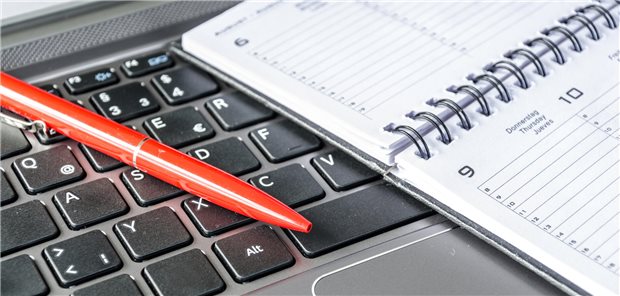Deutscher Phosphattag
Dauerbrenner Dialysepatient und Phosphat
BAD HOMBURG. Die Therapie bei Hyperphosphatämie ist Teamarbeit: Dazu gehören effektive Dialyse, Arzneimittel (Phosphatbinder) sowie phosphatarme Ernährung, erinnert Fresenius Medical Care aus Anlass des 1. Deutschen Phosphattages am 16. November in Bad Homburg.
Bei Dialysepatienten könne selbst das leistungsfähigste Dialyseverfahren, die hochvolumige Hämodiafiltration den Phosphatspiegel nicht in den Normbereich bringen, so ein Statement bei der Veranstaltung.
Also müssten Dialysepatienten zusätzlich Arzneimittel (Phosphatbinder) zu den Mahlzeiteneinnehmen, damit das mit der Nahrung aufgenommene Phosphat direkt gebunden wird und damit unschädlich ist.
Pro Tag könnten so - je nach Nahrung und verordnetem Phosphatbinder - bis zu zwölf zusätzliche Tabletten zusammenkommen. Da sei es nicht verwunderlich, dass momentannoch nicht einmal die Hälfte aller Dialysepatienten in Deutschland den Phosphat-Normbereich erreicht, so der Hersteller.
Als dritte Stellschraube sei die Phosphatzufuhr über die Nahrung von großer Bedeutung. Besonders hoch ist der Phosphatgehalt in proteinreichen Nahrungsmitteln wie Fleisch, Fisch, Milchprodukten. Gerade diese Lebensmittel sollten auf dem Speisezettel von Dialysepatienten aber nicht fehlen, da sonst Proteinmangel und Folgeerscheinungen wie Muskelschwund und Knochenabbau drohen.
Besonders fatale Wirkung im Körper hat die Aufnahme von Phosphatzusätzen in der Nahrung. Diese künstlich zugesetzten Phosphatverbindungen werden vom Körper noch viel besser aufgenommen als die natürlich vorkommenden Phosphate und haben dadurch ein besonders schädigendes Potential.
Phosphat wird mit der Nahrung aufgenommen und ist ein wichtiger Baustein bei der Energiegewinnung und der Knochenbildung.Beim gesunden Menschen sorgen die Nieren für die Entfernung des überschüssigen Phosphats. Problematisch wird es, wenn die Nieren die Phosphatentfernung nicht mehr ausreichend bzw. gar nicht mehr ausüben, wie es bei Dialysepatienten der Fall ist.
Dann steigt der Phosphatwert in einen kritischen Bereich an (Hyperphosphatämie) und wirkt schädigend. Phosphat ist einer der sogenannten "silent killers", also jener Substanzen, die in erhöhter Konzentration keinerlei akute Beschwerden bereiten, sondern Ihre schädigende Wirkung erst im Laufe der Jahre schleichend ausüben.
So trägt ein pathologisch hoher Phosphatwert maßgeblich zu Gefäßverkalkungen und damit zur Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen bei. (eb)