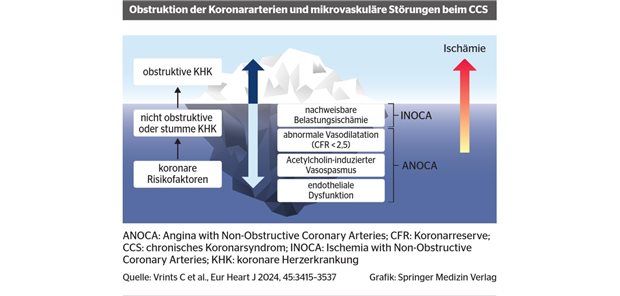Herzinsuffizienz
Gentherapie soll schwache Herzen stärken
Mit neuartigen molekularen Therapien wird heute versucht, eine funktionelle Regeneration des geschädigten Herzmuskels bei chronischer Herzinsuffizienz zu erzielen. Dazu zählt auch die Gentherapie.
Veröffentlicht:MANNHEIM. Bei der Gentherapie der Herzschwäche werden Nuklein-basierte Wirkstoffe, von denen man sich eine funktionelle Regeneration des Herzmuskels verspricht, an Viren gekoppelt, die per Katheter in die Koronargefäße injiziert werden.
Nach ihrer Entwicklung im Labor hat diese innovative Therapie nun die Phase der klinischen Prüfung erreicht.
"Mit Gentherapien können wir erstmals innerhalb der Herzmuskelzelle therapeutisch eingreifen", betonte Professor Patrick Most von der Universität Heidelberg.
Dass der Ansatz im Prinzip funktioniert, konnte an Tiermodellen nachgewiesen werden: Rund 30 Prozent der per Katheter applizierten "Genfähren" erreichen tatsächlich die Herzmuskelzellen.
Most berichtete, dass in den USA derzeit zwei Phase-II-Studien zur Gentherapie bei Herzinsuffizienz laufen. Die CUPID-Studie nutzt ein Gen, das in den Kalziumstoffwechsel eingreift. Die andere Studie setzt auf ein Gen mit Katecholaminwirkung.
Zusammen mit Kollegen des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung hat Most bei der US-Zulassungsbehörde FDA einen Antrag für eine eigene klinische Studie gestellt: "Wir hoffen, dass wir spätestens Ende 2015 starten können."
Molekül namens S100A1 im Visier
Die Heidelberger Forscher koppeln modifizierte Adenoviren mit einem Gen namens S100A1. Es kombiniert die Wirkungsweisen der beiden in den US-Studien eingesetzten Gene.
Most setzt große Hoffnungen in dieses Gen: "In tierexperimentellen Studien ist S100A1 effektiver. Unser Ansatz bietet zudem die Möglichkeit, die Wirkstärke gezielt anzupassen."
Auch ein etwas anderer Applikationsweg soll gewählt werden: Der Katheter wird über die Koronarvenen eingeführt, um das Kapillarbett des Herzens besser erreichen zu können.
Selbst wenn die Studie tatsächlich im Jahr 2015 startet, dürfte es bis zu einem breiten klinischen Einsatz noch dauern. Viele Fragen sind nämlich noch unbeantwortet. So wird nach Wegen gesucht, die verhindern, dass ein Teil der Patienten das Virus gleich nach Injektion inaktiviert.
Offen ist auch, ob die Funktion der Herzmuskelzellen durch die einmalige Injektion der Gene dauerhaft verbessert wird und ob die Behandlung am Ende auch die Prognose der Patienten verbessert.
Die Ergebnisse der Tierversuche stimmen Most in allen Punkten zuversichtlich. Aber versprechen kann er nichts. (gvg)