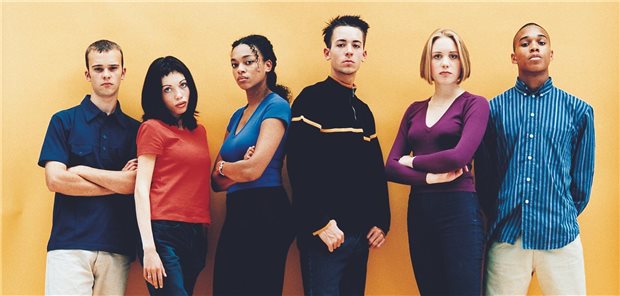Hausärzte sind meist erste Ansprechpartner bei Depressionen
In Deutschland leben etwa vier Millionen behandlungsbedürftige Patienten mit Depression, von denen etwa zwei Drittel von Hausärzten betreut werden. Die meisten Patienten profitieren von einer Behandlung mit Antidepressiva. Besonders bei schweren Depressionen besteht die Gefahr von Rezidiven, wenn das Medikament zu schnell abgesetzt wird. Um Rezidiven vorzubeugen, wird deshalb empfohlen, nach Abklingen der Depression die Pharmakotherapie mindestens für ein halbes Jahr fortzuführen.
Veröffentlicht:Patienten mit Depressionen suchen ihren Hausarzt meist nicht wegen ihres Stimmungstiefs auf, sondern aufgrund somatischer Beschwerden, etwa Bauchschmerzen oder Engegefühl in der Brust, für die dann keine organischen Ursachen gefunden werden können. Häufig berichten sie außerdem über Schlafstörungen, Tagesmüdigkeit, Appetitlosigkeit oder Interessenlosigkeit.
Vor Antidepressiva-Therapie ist oft Überzeugungsarbeit zu leisten
Eine Therapie mit Antidepressiva ist Studiendaten zufolge bei zwei Drittel bis drei Viertel der Patienten wirksam. Viele Patienten lehnen jedoch eine solche Behandlung ab. Zum Teil akzeptieren sie die Diagnose nicht, weil sie die Depression für eine Geisteskrankheit halten ("Ich hab doch keinen Klaps!") und weil sie meinen, es müsse eine organische Ursache zu finden sein. Hier kann es weiterhelfen, wenn man ihnen die Depression als hirnorganische Erkrankung erklärt, die durch einen Mangel an bestimmten Neurotransmittern ausgelöst wird.
Zum Teil lehnen die Betroffenen eine Antidepressiva-Therapie ab, weil sie zu Unrecht befürchten, abhängig zu werden. Hier kann es nach Erfahrungen von Experten sinnvoll sein, zunächst eine Therapie mit einem standardisierten Johanniskraut-Extrakt zu beginnen.
Denn Phytopharmaka stehen bei den Deutschen hoch im Kurs, wie eine repräsentative EMNID-Umfrage vor einigen Jahren ergeben hat. Bei nicht ausreichender Besserung ist es dann leichter, auf ein synthetisches Antidepressivum umzusteigen.
Für die Therapie bei Depressionen steht inzwischen eine breite Palette von Antidepressiva aus unterschiedlichen Substanzklassen zur Verfügung, so daß eine individuell abgestimmte Therapie möglich ist. Bei leichten bis mittelschweren Depressionen zugelassen sind standardisierte Johanniskraut-Extrakte.
Deren Wirksamkeit ist in Placebo-kontrollierten Studien und in Vergleichsstudien mit synthetischen Antidepressiva, zum Beispiel mit Imipramin, Amitriptylin oder Fluoxetin, bei Patienten mit leichten bis mittelschweren Depressionen erbracht worden.
Wichtige Kriterien bei der Wahl des individuell geeigneten synthetischen Antidepressivum sind Wirksamkeit, schwere der Depression, Begleiterkrankungen, Komedikation und Nebenwirkungsprofil. Patienten mit agitierten Depressionen profitieren von sedierenden Substanzen wie Amitriptylin, Doxepin, Amitriptylinoxid, Nortriptylin, Maprotilin oder Mirtazapin.
Bei Patienten mit gehemmter Symptomatik kann mit nicht-sedierenden Antidepressiva wie Imipramin, den Serotonin-Wiederaufnahmehemmern (SSRI) Citalopram, Escitalopram, Fluoxetin, Fluvoxamin, Paroxetin oder Sertralin behandelt werden. Eine Alternative sind Moclobemid, Venlafaxin, Reboxetin oder der vor kurzem auf den Markt gekommene kombinierte Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer Duloxetin. In klinischen Placebo-kontrollierten Studien wurde mit Duloxetin (60 mg / Tag) nach neun Wochen bei 44 Prozent der Patienten eine Remission erzielt, mit Placebo lediglich bei 16 Prozent.
Erste Beurteilung der Therapie nach etwa vier Wochen
Die neueren SSRI und Reboxetin sind besser verträglich als die Trizyklika. Sie haben keine ausgeprägte anticholinerge oder kardiotoxische Wirkung, daher sind sie für ältere Menschen gut geeignet. Wichtig ist, daß Antidepressiva in ausreichend hoher Dosierung und auch lange genug eingenommen werden.
Besonders bei älteren Patienten sollten initial niedrige Dosierungen gewählt werden, die dann langsam gesteigert werden, da im Alter der Abbau in der Leber und die renale Elimination verändert sind. Eine Beurteilung, ob die Therapie wirkt, sollte nach etwa vier Wochen erfolgen. Nach Abklingen der Symptome wird die Therapie noch für mindestens weitere sechs Monate fortgeführt, um Rezidive zu vermeiden. (mar)