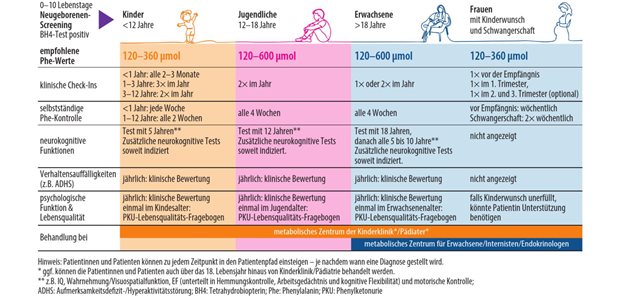Schwerer Immundefekt
IQWiG sieht Nutzen für SCID-Screening
Einen Anhaltspunkt für einen Nutzen bescheinigt das IQWiG dem Neugeborenen-Screening auf SCID in seinem Abschlussbericht zur Bewertung.
Veröffentlicht:KÖLN. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) hat den Nutzen eines Screenings von Neugeborenen auf einen schweren kombinierten Immundefekt (Severe combined Immunodeficiency,SCID) untersucht. Aus der Bewertung ergibt sich ein Anhaltspunkt für einen Nutzen des Screenings, teilt das IQWiG mit.
Eine frühe Untersuchung kombiniert mit einer Infektionsprophylaxe und einer kurativen Anschlussbehandlung (allogene Knochenmark- oder Stammzelltransplantation) könne schwere oder tödliche Infektionen bei den betroffenen Kindern vermeiden.
Weil SCID eine extrem seltene und schwere Erkrankung ist, hatte das IQWiG den methodischen Rahmen für die Nutzenbewertung weit gefasst: von Analysen einzelner Bausteine der Screening-Kette bis hin zu Studien niedriger Evidenzstufen, etwa retrospektiven Analysen. Zwei vergleichende Interventionsstudien liefern verwertbare Ergebnisse zur Sterblichkeit (Mortalität).
Daten zum Auftreten von Infektionen (Morbidität) wurden nur unvollständig berichtet, deshalb ist zu diesem Endpunkt keine Nutzenaussage möglich, heißt es in der Mitteilung. Zu allen anderen Endpunkten (z. B. Krankenhausaufenthalte, Entwicklungsstörungen, gesundheitsbezogene Lebensqualität) lagen keine Studienergebnisse vor.
Studien in anderen Ländern
Eine Interventionsstudie in Frankreich läuft noch bis Juni 2018 und lässt auch Daten zum Nutzen erwarten.
Eine retrospektive Analyse der Daten von 108 Kindern in zwei englischen Krankenhäusern zeigte einen deutlichen Unterschied zwischen den Behandlungsgruppen: In der Gruppe von 60 Patienten mit frühem Behandlungsbeginn gab es sechs Todesfälle(10 Prozent), in der Gruppe mit späterem Therapiebeginn starben 29 von 48 Patienten(60 Prozent).
Auch in einer zweiten Studie zeigte sich ein deutlicher Vorteil bei einer früheren (Alter < 3,5 Monate) im Vergleich zu einer späteren Transplantation(Alter > 3,5 Monate). Von 21 Kindern der Interventionsgruppe starb eines (5 Prozent), in der Vergleichsgruppe mit 96 Patienten kam es zu 25 Todesfällen (26 Prozent).
Insgesamt lässt sich daraus ein Anhaltspunkt für einen Nutzen des früheren Behandlungsbeginns mit einer Infektionsprophylaxe und anschließender Stammzelltransplantation ableiten. Eingeschränkt ist die Ergebnissicherheit durch das Studiendesign (nicht randomisiert und retrospektiv) und die Unvollständigkeit der Daten, so das IQWiG. (eb)
Der Abschlussbericht des IQWiG ist einsehbar auf: www.iqwig.de