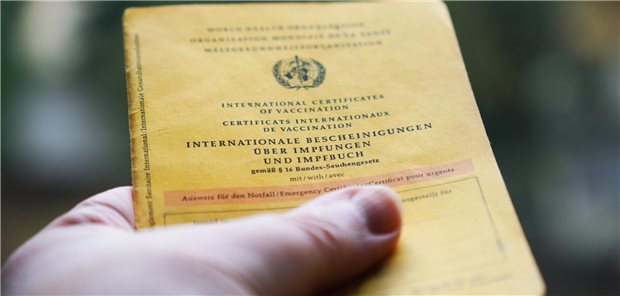Neue Immuntherapien gegen Krebs
Tumoren entstehen, weil sich bösartig veränderte Zellen den Mechanismen der Immunabwehr entziehen. Aber die Forscher arbeiten an immunologischen Gegenstrategien - bei einigen Tumoren mit Erfolg
Veröffentlicht: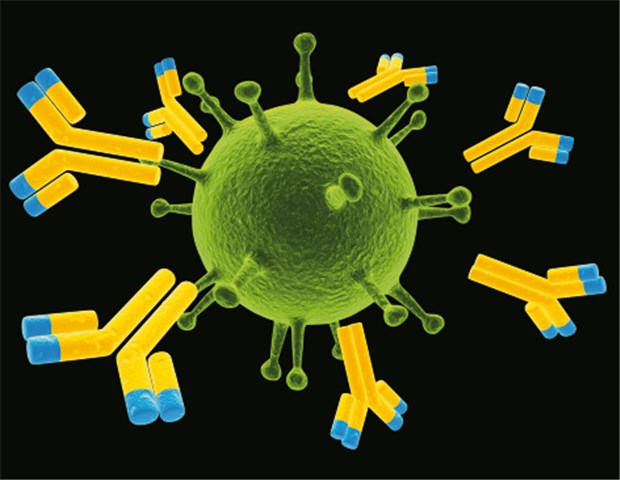
Antikörper lassen sich auch spezifisch für die Zerstörung von Tumorzellen verwenden. © S.Kaulitzki/Fotolia.de
© S.Kaulitzki/Fotolia.de
NEU-ISENBURG. Das Immunsystem ist ein ständiger, lebensnotwendiger Wächter: Nicht nur Krankheitserreger müssen eliminiert werden, auch bösartig veränderte, körpereigene Zellen. Meist scheint dies zu funktionieren. Der gegenwärtigen wissenschaftlichen Auffassung zu Folge entstehen im Verlauf des Lebens immer wieder Tumorzellen, und meist werden sie vom Immunsystem zerstört, bevor sie schaden könnten. Die erhöhte Krebshäufigkeit bei Patienten mit dauerhaft geschwächtem Immunsystem gilt als einer der wichtigsten Belege für diese Theorie.
Aus ihr folgt auch: Versagen im Einzelfall immunologische Abwehrmechanismen gegen Krebs, sollte es möglich sein, der Körperabwehr auf die Sprünge zu helfen. Immuntherapien gegen Krebs werden seit den 80er Jahren erprobt. Dabei erfolgen die Aktivierungen des Immunsystems krebsunspezifisch oder aber tumorspezifisch.
BCG-Vakzine erfolgreich bei Harnblasenkrebs
So gilt als erfolgreichste Immuntherapie solider Tumoren die Impfung gegen Harnblasenkrebs mit einem Tuberkulose-Impfstoff, der BCG-Vakzine (Bacille Calmette-Guérin). Der französische Name steht für einen Stamm von Tuberkelbazillen, der bei Menschen ungefährlich ist. Bei Harnblasenkrebs mit hohem Risiko für einen Rückfall wird die BCG-Vakzine mehrfach direkt in die Harnblase des Patienten gespritzt. Die Impfung ist tumorunspezifisch, löst aber komplexe Immunreaktionen aus, darunter eine Aktivierung der natürlichen Killerzellen. Diese Zellen können veränderte körpereigene Zellen, wie es Tumorzellen sind, abtöten. Das Risiko für Tumorrezidive wird durch die BCG-Vakzine um bis zu 50 Prozent gesenkt.
Ebenfalls tumorunspezifisch, aber hoch wirksam können Therapien mit Botenstoffen des Immunsystems (Zytokine) sein, zum Beispiel Interferone oder Interleukine. Zytokine vermitteln die biochemischen Signale zwischen den Zellen, die bei einer Immunantwort zusammenwirken, etwa Lymphozyten, Makrophagen und dendritische Zellen.
Die Zytokinbehandlung ist erfolgreich beim Harnblasenkarzinom erprobt worden, unter anderem in Kombination mit der BCG-Vakzine. Aber auch beim Melanom hat sich eine Zytokintherapie mit Interleukin 2 (IL-2) als wirksam erwiesen. In den USA ist dieses Mittel deshalb zur Behandlung von Patienten mit metastasiertem Melanom zugelassen, in Europa allerdings nicht - aufgrund der unerwünschter Wirkungen des Interleukins.
Eine weitere Strategie der Immuntherapie gegen Krebs ist die Behandlung mit Antikörpern. So werden zum Beispiel die monoklonalen Antikörper Trastuzumab und Rituximab bei Patienten mit Brustkrebs und Lymphomen angewandt, häufig in Kombination mit Hormon- und Zytostatika-Behandlung. Solche dem Patienten injizierten Antikörper binden passiv an Oberflächenmoleküle auf Tumorzellen.
Antikörper beugt Neuroblastom-Rezidiv vor
In einer Studie im vergangenen Jahr mit 226 Kindern mit Neuroblastom beugte die Verabreichung eines Antikörpers gegen das Tumormolekül GD2 Rezidiven dieses Tumors vor, wenn die Patienten den Antikörper im Anschluss an die herkömmliche Therapie erhielten.
Bei der aktiven Tumorimpfung soll der Körper des Patienten selbst Antikörper und tumorspezifische T-Lymphozyten bilden, die die malignen Zellen gezielt und nebenwirkungsarm zerstören und ein lang anhaltendes, immunologisches Gedächtnis hervorrufen. Noch hat sich im Klinikalltag kein Verfahren der aktiven Immunisierung gegen Krebs etabliert, aber die Ergebnisse neuer, großer klinischer Studien sind vielversprechend.
Beispiel: Melanom. Eine Impfung mit dem Eiweißbaustein gp100 - die Buchstaben stehen für Glykoprotein -, kombiniert mit einem unspezifischen Immunverstärker, brachte in einer Studie mit 185 Patienten mit fortgeschrittenem Melanom Geimpften einen Überlebensvorteil von durchschnittlich fünf Monaten - sie lebten damit knapp eineinhalb Jahre, Nichtgeimpfte lebten im Mittel nur ein Jahr.
Aktivierte dendritische Zellen bekämpfen Melanom
Ebenfalls positive Effekte sind beobachtet worden, wenn Patienten mit Melanom dendritische Zellen entnommen, außerhalb des Körpers mit Tumorantigenen beladen und wieder reinfundiert werden. Dendritische Zellen arbeiten der Immunabwehr zu, indem sie auf ihrer Oberfläche Bruchstücke körperfremder und körpereigener Eiweiße den Lymphozyten zur Erkennung präsentieren.
Fortschritte gibt es auch bei hämatologischen Malignomen. So ließ sich bei Patienten mit Non-Hodgkin-Lymphomen durch die aktive Impfung mit tumorspezifischen Proteinen die Überlebenszeit ohne Krankheitszeichen von durchschnittlich 30 Monaten auf 44 Monate verlängern. Tumorvakzine werden wahrscheinlich künftig andere Verfahren im Sinne einer multimodalen Therapie ergänzen und vielleicht sogar prophylaktisch bei Hochrisikopatienten angewandt werden.
(nsi)
(eb)