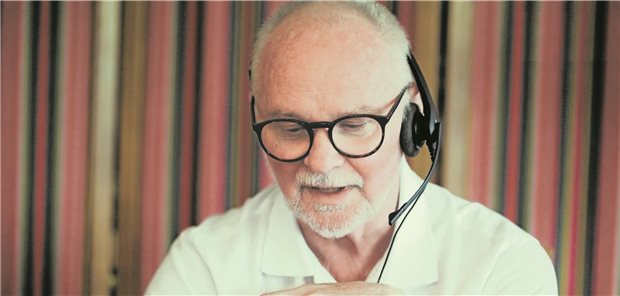Telemedizin: die politische Debatte ist eröffnet
Ist die telemedizinische Überwachung von Herzinsuffizienz-Patienten medizinisch sinnvoll und ökonomisch vertretbar? Diese Fragen sollte die vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Studie TIM-HF klären. Stattdessen gibt es erst einmal viele neue Fragen.
Veröffentlicht:
Das Telemedizin-Zentrum, in dem Ärzte alarmiert werden, sobald die Werte der Patienten aus dem Ruder laufen. Die Datenübertragung erfolgt halb automatisch.
© Bosch
BERLIN/CHICAGO. Nach dem Abschluss der Telemedizinstudie TIM-HF ("Partnership for the Heart") wird jetzt darüber diskutiert, wie und für wen Krankenkassen das Verfahren am besten anbieten sollten. Auch die Diskussion über das unerwartete Ergebnis ist noch nicht beendet.
Die TIM-HF-Studie des vom Bundeswirtschaftsministerium mit acht Millionen Euro unterstützten "Partnership for the Heart"-Konsortiums war Thema beim Kardiologenkongress AHA 2010 in Chicago und bei der Medica in Düsseldorf.
Teilnehmer waren Herzinsuffizienzpatienten der NYHA-Klassen II/III, die entweder bei einer LVEF von maximal 35 Prozent schon einmal dekompensiert waren oder aber ohne Dekompensation eine LVEF von maximal 25 Prozent hatten.
Die Studie zeigte, wie bereits berichtet, über zwei Jahre keinen signifikanten Unterschied zwischen Telemedizingruppe und Standardbehandlung beim primären Endpunkt (Gesamtmortalität) und bei wesentlichen sekundären Endpunkten, darunter Klinikeinweisungen.
In mehreren prädefinierten Subgruppen gab es bei sekundären Endpunkten einen Trend zugunsten der Telemedizin. Eine Signifikanz wurde aber erst erreicht, wenn drei dieser Subgruppen (nicht depressiv, LVEF größer 25 Prozent und schon mal dekompensiert) zusammengefasst wurden. Für diese etwa 50 Prozent der Studienteilnehmer war die kardiovaskuläre Mortalität 52 Prozent geringer.
Ein Grund dafür, dass die Telemedizin in der Gesamtkohorte nicht besser war, sieht Studienleiter Professor Friedrich Köhler in der hervorragenden Versorgung der Patienten.
"Die Gesamtmortalität lag in beiden Gruppen lediglich bei 8,2 Prozent." Das ist für diese Patienten wenig, sodass die These wäre, dass die zusätzliche Telemedizin statistisch nicht ins Gewicht fiel.
Eine andere Erklärung für das unerwartete Ergebnis könnte sein, dass positive Vorstudien, die den Anlass für die Wahl der Endpunkte in TIM-HF gegeben hatten, statistisch unterpowert waren.
Eine kürzlich publizierte Metaanalyse, die für die Telemedizin bei Herzinsuffizienz eine Senkung der Gesamtmortalität reklamiert hatte, wurde in den Diskussionen in Chicago wegen ihrer Methodik und Studienauswahl jedenfalls stark kritisiert.
Politisch stellt sich jetzt die Frage, wie es mit den Bestrebungen weitergeht, die Telemedizin bei Herzinsuffizienz in Richtung Regelversorgung voranzutreiben.
Barmer-GEK-Vorstand Dr. Rolf-Ulrich Schlenker betonte, dass er zunächst einmal die gesundheitsökonomischen Analysen zu TIM-HF abwarten möchte, die für das Frühjahr 2011 erwartet werden.
"Grundsätzlich schafft die TIM-HF-Studie aber Klarheit darüber, wem Telemedizin bei Herzinsuffizienz wirklich hilft, nämlich rund zehn Prozent aller Herzinsuffizienzpatienten. Das ist aus unserer Sicht ein ideales Ergebnis", so Schlenker.
Der Kassenmanager betonte, dass man durchaus darüber nachdenken könne, Telemedizin bei einem eng umschriebenen Patientenkollektiv "für die Regelversorgung aufzuschließen". Für die Einzelkasse gehe es jetzt allerdings zunächst darum, individuelle Versorgungsverträge zu schaffen oder anzupassen.
Charité-Chef Professor Karl Max Einhäupl wies darauf hin, dass vor einer Überführung in die Regelversorgung weitere Studien nötig seien, in denen die jetzt identifizierte Subgruppe im Hinblick auf den Nutzen der Telemedizin gezielt evaluiert werde.
Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle möchte nicht so lange warten: "Die Studienergebnisse müssen jetzt rasch in praktisches Handeln umgesetzt werden, zumal dadurch auch Kosten eingespart werden können. Vor allem in strukturschwachen Gebieten sehe ich große Chancen für die Telemedizin", sagte der Wirtschaftsminister.
Lesen Sie dazu auch: Telemedizin bei Herzinsuffizienz: Die Sicht wird klarer Telemonitoring hilft - aber nicht allen Patienten