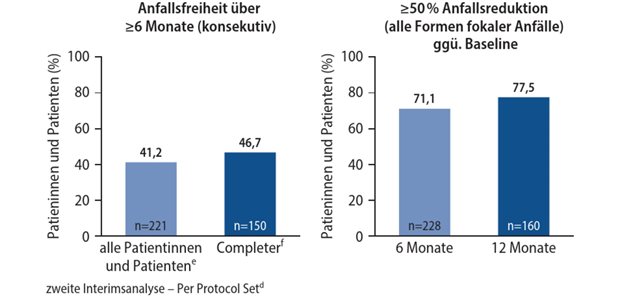HINTERGRUND
Demenz-Tests und Berichte von Angehörigen - damit lassen sich Therapie-Effekte bei Alzheimer überprüfen
Wann bei Alzheimer-Patienten eine Therapie mit Cholinesterase-Hemmern begonnen werden sollte, ist klar: gleich dann, wenn die Diagnose feststeht. Schwieriger ist dagegen zu beurteilen, wie lange Patienten behandelt werden sollten und was geschehen sollte, wenn die Medikation nicht die gewünschte Wirkung zeigt.
Um überhaupt Chancen für einen Therapie-Erfolg mit Cholinesterase-Hemmern zu haben, ist schon beim Start der Behandlung einiges zu beachten. So sollten die Patienten möglichst keine Bradyarrhythmien haben. Daran hat Privatdozent Martin Haupt vom Neuro-Centrum in Düsseldorf erinnert. Patienten mit Bradyarrhythmien benötigten meist einen Schrittmacher, und nach dessen Implantation stehe einer Therapie mit Cholinesterase-Hemmern nichts mehr im Wege, sagte Haupt bei einer Veranstaltung von Eisai und Pfizer in Mannheim.
Gespräch mit Facharzt vor Therapiestart kann nützlich sein
Bei BPH und nachtröpfelndem Urin oder bei Patienten, die in der Vergangenheit Magen-Ulzera oder Morbus Crohn hatten, sei prinzipiell eine Therapie mit Cholinesterase-Hemmern möglich. Haupt rät jedoch zuvor zu einem Gespräch mit einem Urologen oder Internisten. Spricht von Seiten der Fachkollegen nichts gegen die Therapie, könne man mit niedrigen Dosierungen beginnen und die Dosis langsam steigern.
Hat man eine Therapie mit Antidementiva begonnen, fällt es bekanntlich nicht immer leicht zu erkennen, ob die Patienten darauf ansprechen. Ein eindeutiger Therapie-Erfolg liegt nicht nur dann vor, wenn sich die kognitiven Fähigkeiten bessern, betonte Haupt. Sondern als Therapie-Erfolg sei auch klar zu werten, wenn der voranschreitende Verlust der kognitiven Fähigkeiten - zumindest vorübergehend - gestoppt oder wenigstens gebremst werde.
Daher sollte der Krankheitsverlauf unter der Therapie genau beobachtet werden, etwa, indem man die kognitiven Leistungen mit Demenz-Tests dokumentiert. Geeignet sind dafür Tests wie der DemTect® oder der Mini-Mental-Status-Test (MMST). Sinnvoll sei auch ein Demenz-Test zum Zeitpunkt des Therapiestarts. Damit habe man einen Bezugspunkt, um später den Erfolg einer antidementiven Behandlung zu beurteilen.
Wichtig ist aber auch die Rückmeldung von den pflegenden Angehörigen. Spätestens sechs Wochen nach Therapiebeginn sei es wichtig, sie gezielt etwa danach zu fragen, wie die Demenz-Kranken im Alltag zurechtkommen, sagte Haupt.
So könne es sein, dass unter der antidementiven Therapie die Patienten plötzlich wieder allein telefonieren können, oder dass ihnen wieder die Namen von Personen einfallen, denen sie begegnen. Solche Veränderungen sollte man dokumentieren, denn sie bedeuten, dass die Krankheitsprogression bei den Patienten vorübergehend gestoppt wird und sie auf die Medikation gut ansprechen.
Verschlechtern sich die kognitiven Leistungen später wieder, ist das nicht unbedingt ein Zeichen, dass die Medikation nicht mehr wirkt: Aus Studien wisse man, dass die kognitiven Leistungen der Patienten dann immer noch deutlich besser sind als bei unbehandelten Demenz-Kranken, sagte Haupt.
Der Unterschied bei der Krankheitsprogression könne ein bis zwei Jahre betragen. Setze man nun die Medikation ab, könnten die Patienten den Vorteil, den sie durch die Medikation hatten, schnell wieder verlieren und zudem nicht wieder aufholen, wenn man später die Medikation neu ansetzt.
Im Zweifel lässt sich der Erfolg per Auslassversuch überprüfen
Dies sollte man auch beachten, wenn sich die kognitive Leistung nach Beginn einer antidementiven Behandlung weiter verschlechtert. Auch hier könne es sein, dass die Krankheitsprogression langsamer ist als ohne Medikation. Im Zweifel lässt sich das nur durch einen Auslassversuch feststellen.
Kommt der betreuende Kollege aufgrund der Berichte der pflegenden Angehörigen, der eigenen Einschätzung der Gesamtsituation und der Ergebnisse von Demenz-Test zu dem Schluss, dass die gewählte antidementive Therapie keinen erkennbaren Einfluss auf die Progression der Krankheit hat, rät Haupt zu einem Wechsel des Medikamentes. In mehreren Studien hätten nach einem Wechsel auf einen anderen Cholinesterase-Hemmer etwa die Hälfte der Patienten gut angesprochen und die Therapie erfolgreich fortgeführt.
Wie lange sollte man aber Alzheimer-Kranke antidementiv behandeln? "Man muss nicht zwangsläufig bis zum Lebensende Antidementiva geben. Man sollte aber auch nicht unbedingt abbrechen, wenn ein bestimmter Wert auf der Mini-Mental-Skala erreicht ist", sagte Haupt.
Über einen Stopp der antidementiven Therapie sollte etwa dann nachgedacht werden, wenn ein Auslassversuch ohne erkennbaren Effekt bleibt, oder wenn die Symptome auch bei guter Compliance fortschreiten. "Wenn jemand regungslos im Bett liegt und mit anderen Menschen nicht mehr kommunizieren kann, braucht er kein Antidementivum", so Haupt.
STICHWORT
DemTect®
Der Test DemTect® dauert sieben bis zehn Minuten. Er kann von geschultem Personal abgenommen werden. Bei den fünf Untertests müssen zehn vorgelesene Worte, zum Beispiel "Teller" oder "Apfel", sofort auswendig wiederholt werden, es müssen Zahlen als Zahlwort und umgekehrt Zahlwörter als Zahlen geschrieben und in einer Minute möglichst viele im Supermarkt erhältliche Dinge genannt werden, und es müssen Zahlenfolgen in umgekehrter Reihenfolge wiederholt und die eingangs genannten zehn Begriffe nochmals wiederholt werden.
Den Demenz-Test gibt es bei Herstellern von Antidementiva. (mut)
MMST
Einer der bekanntesten Demenz-Tests ist der Mini-Mental-Test (Mini-Mental State Examination, MMSE). Werden die standardisierten Aufgaben zur zeitlichen und räumlichen Orientierung, zu Erinnerung, Aufmerksamkeit, Sprache und Kopfrechnen richtig gelöst, können maximal 30 Punkte erreicht werden. Der Test dauert etwa zehn Minuten. Ausführlichere Checks werden empfohlen bei 26 oder weniger Punkten.
Den Mini-Mental-Status-Test gibt es bei Herstellern von Antidementiva, aber auch bei der Testzentrale Göttingen, Robert-Bosch-Breite 25, 37079 Göttingen, Tel.: 05 51 / 50 68 80, Fax: - 506 88 24) (mut)