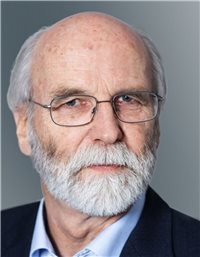Prognose
D-Dimer als Biomarker auch beim Melanom?
Nicht nur bei soliden Tumoren etwa der Lunge und des Darms sind erhöhte D-Dimer-Werte mit einer schlechten Prognose assoziiert, sondern auch beim Melanom. Das hat eine aktuelle Studie ergeben.
Veröffentlicht:MANNHEIM. Schon länger ist bekannt, dass bei Krebspatienten D-Dimer verstärkt gebildet wird. Die erhöhten Mengen der quervernetzten Fibrinspaltprodukte kommen auch bei Patienten mit Mamma-, Ovarial- und Pankreasadenokarzinom im Plasma vor. Für Patienten mit einem Melanom gab es bisher noch keine eindeutigen Hinweise darauf.
Aus der Arbeitsgruppe um Professor W. Schneider von der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie am Universitätsklinikum Mannheim haben deshalb Dr. rer. nat. Anna Desch und ihre Kollegen geprüft, ob solche Anzeichen für eine Hyperkoagulabilität und Fibrinolyse als prognostische Biomarker bei Patienten mit fortgeschrittenem oder disseminiertem Melanom geeignet sind.
Dazu werteten sie in der bisher größten Kohortenstudie die Befunde von 533 Melanompatienten im Stadium I bis IV des Hautkrebszentrums in Mannheim aus (Int J Cancer 2016; online 14. November). Das retrospektive Follow-up lag beim Parameter "progressionsfreies Überleben" bei fünf Jahren, beim Parameter "Gesamtüberleben" bei zwei Jahren. Bei allen Patienten war das Melanom histologisch bestätigt.
Vollautomatische Bestimmung
Die D-Dimer-Bestimmung im Plasma wurde vollautomatisch per Immunturbidimetrie mithilfe des Systems Innovance® Dade Behring (BCS-System) vorgenommen. Als Cut-off-Wert wurde eine D-Dimer-Konzentration von 0,6 mg/l gewählt, und zwar auf der Grundlage der Ergebnisse der ROC-Analyse (Receiver Operating Characteristic).
Im Median waren die Patienten je nach Tumorstadium zwischen 61 und 67 Jahre alt (median 64). Als progressionsfreies Überleben wurde die Zeit ab Diagnose des Stadiums III bis zur Progression innerhalb des Fünf-Jahres-Follow-up gewertet. Die Überlebenszeit wurde ab Stadium IV bis zum Tod oder bis zur letzten Überprüfung innerhalb des Zwei-Jahres-Follow-up gemessen.
Mehr als 500 Patienten
Von den mehr als 500 Patienten hatten nicht alle erhöhte D-Dimerwerte, sondern mit 145 (27,2 Prozent) nur etwas mehr als ein Viertel. Nach Angaben von Desch und ihren Kollegen korrelierten die erhöhten Mengen positiv und signifikant mit der Tumordicke (=2 mm), der Lymphknotenbeteiligung und der Metastasierung.
Die Multivariat-Analyse ergab schließlich, dass bei Patienten mit erhöhten D-Dimer-Testergebnissen verglichen mit Patienten ohne erhöhte Werte die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung fortschreitet, um fast das Eineinhalbfache erhöht war (Hazard Ratio [HR]: 2,47; 95%-Konfidenzintervall zwischen 1,23 und 4,98; p = 0,012). Die Gesamtsterberate war verdoppelt (HR: 2,01; 95%-Konfidenzintervall zwischen 0,09 und 4,45; p = 0,087). Hier hatte der D-Dimer-Wert einen höheren Vorhersagewert als das Metastasierungsstadium sowie die Biomarker LDH und S100B.
Schließlich haben Desch und ihre Kollegen sich die Entwicklung der D-Dimerkonzentrationen in den letzten Stadien vor dem Tod genauer angeschaut. Sie entdeckten, dass die Mengen der Spaltprodukte vom Zeitpunkt zwischen 24 und 28 Wochen bis zum Zeitpunkt zwischen 0 und 8 Wochen vor dem Tod signifikant gestiegen waren (p = 0,0003), und zwar von 0,71 mg/l auf 2,4 mg/l.
D-Dimerkonzentration steigt kurz vor dem Tod
Die Forscher erinnern daran, dass in Studien bereits mit einer medikamentösen Antikoagulation die hämatogene Metastasierung verhindert werden konnte und eine therapeutische Intervention gegen die Absiedlungen möglich war. Und es gebe vermehrt Hinweise, dass die Behandlung mit niedermolekularen Heparinen (NMH) einen direkten antitumoralen Effekt hat und sowohl das progressionsfreie als auch das Gesamtüberleben positiv beeinflusst.
Sie hätten zudem in In-vitro- und In-vivo-Studien gezeigt, dass NMH sowohl die Angiogenese und die Krebszelladhäsion als auch die Vermehrung der Zellen, das lokale Tumorwachstum sowie die Metastasierung beeinflussen.
Ergebnis einer Kohortenstudie:
Erhöhte D-Dimerwerte hatten 27,2 Prozent von 533 Melanompatienten im Stadium I bis IV.
Die erhöhten Mengen korrelierten positiv und signifikant mit der Tumordicke (=2 mm), der Lymphknotenbeteiligung und der Metastasierung.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Erkrankung fortschreitet, war um fast das Eineinhalbfache erhöht.