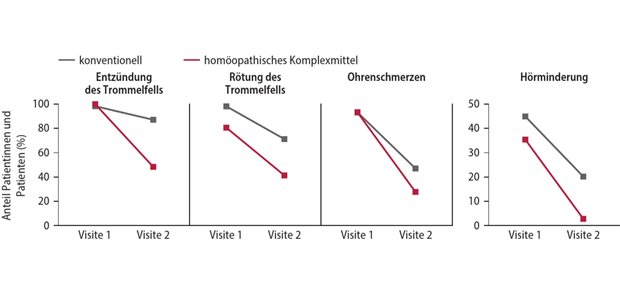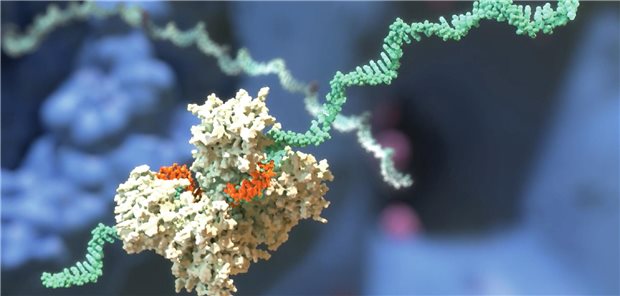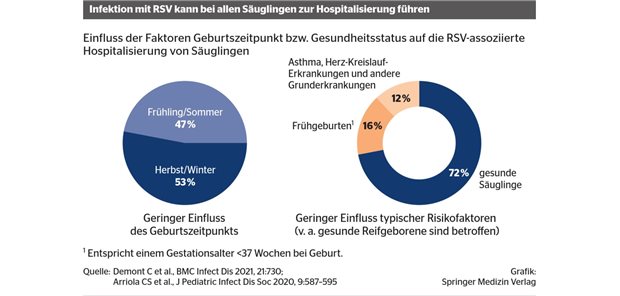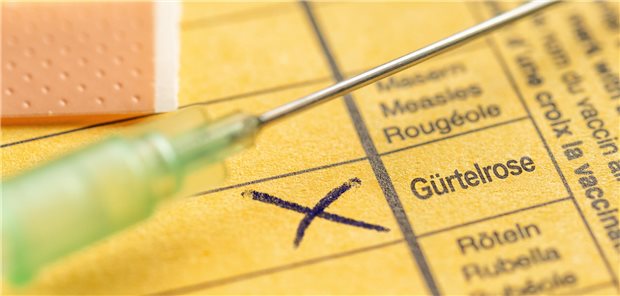Projekt iHEAR
Gentherapie könnte Taubheit heilen
Der Europäische Forschungsrat zeichnet Forscher aus, die Gehörlose von ihrer Krankheit heilen wollen. Die Idee: Die fehlerhaften Gene austauschen.
Veröffentlicht:
Rund die Hälfte der mit Taubheit geborenen Kinder haben einen Gendefekt, der die Erkrankung auslöst.
© Arto / stock.adobe.com
HANNOVER. Professor Axel Schambach hat von der EU die Auszeichnung „Consolidator Grant“ des Europäischen Forschungsrates „European Research Council“ (ERC) erhalten, teilt die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) mit. Damit verbunden ist eine Förderung seiner Wissenschaft in Höhe von rund zwei Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre.
Der Leiter des MHH-Instituts für Experimentelle Hämatologie nutzt die Förderung für das Projekt iHEAR, dessen langfristiges Ziel es ist, Kinder und Erwachsene vor Taubheit zu schützen. Die Anzahl der Betroffenen ist groß: Etwa zwei bis fünf von tausend Kindern werden taub geboren.
Eine Sache der Gene
Bei rund der Hälfte der taub geborenen Kinder liegt die Gehörlosigkeit daran, dass ein oder mehrere Gene nicht funktionieren, heißt es in der Mitteilung. Derzeit sind rund 100 Gene bekannt, deren Fehlfunktionen zur Taubheit führen können.
Das iHEAR-Team will Taubheit mit Gentherapie heilen. Dabei konzentriert es sich auf Gene, die für die zum Hören notwendigen Haar- und Sinneszellen im Innenohr verantwortlich sind. Das Ziel: Genfähren (lentivirale und adenoassoziierte Virus-Vektoren) ins Innenohr zu injizieren, die mit der funktionierenden Version des Gens beladen sind.
Die Fähren sollen das Gen in die Haar- und Sinneszellen bringen, damit das fehlende Protein gebildet werden kann und die Zellen wieder funktionieren. Dem Team geht es laut Mitteilung zudem darum, mit Hilfe der Gentherapie spontaner Ertaubung entgegenzuwirken. Diese kann durch die Behandlung mit Medikamenten wie etwa bestimmten Chemotherapeutika entstehen.
Hierbei soll die Gentherapie die ungewollte Aufnahme der Medikamente in die Haarzellen verhindern beziehungsweise das Herauspumpen des Medikaments aus diesen empfindlichen Zellen bewirken. Die Studien werden zunächst anhand von Zellversuchen und in Modellsystemen durchgeführt, so die MHH.
Auch für Behandlung der Altersschwerhörigkeit geeignet?
Damit die Forschungsergebnisse möglichst bald auch am Menschen angewendet werden können, entwickeln sie auch selber patientenspezifische Erkrankungsmodelle. Diese basieren auf induzierten pluripotenten Stammzellen, die – im Falle dieses Projekts – von Zellen gehörloser Menschen abstammen.
Das Forschungsteam geht davon aus, dass die Arbeiten nicht nur Kindern und jungen Erwachsenen nützen werden: „Wir hoffen, dass die von uns erzielten Ergebnisse langfristig auch zur Therapie der Altersschwerhörigkeit beitragen“, wird Schambach in der Mitteilung zitiert. (eb)