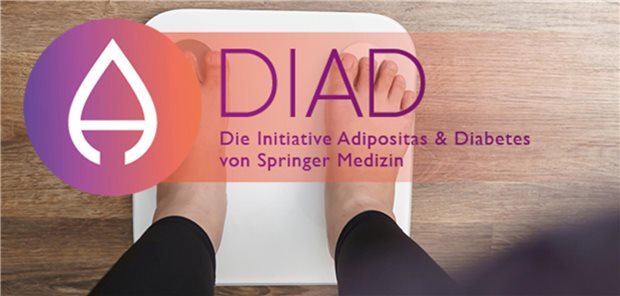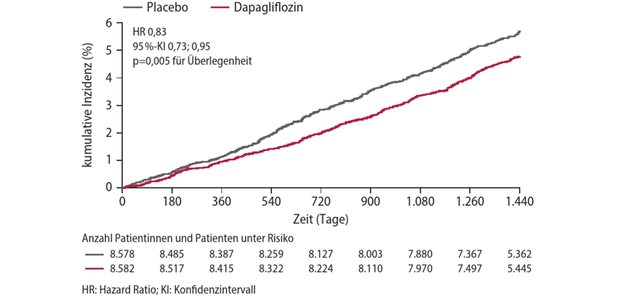Diabetes
Große Hoffnung in spezielle Psychotherapie
Behandlung durch geschulte Psychotherapeuten kann zu besserer somatischer Prognose und höherer Lebensqualität der Patienten führen.
Veröffentlicht:
Bei der psychotherapeutischen Versorgung von Diabetikern ist es nach Expertenmeinung wichtig, dass sich die Therapeuten mit dem Krankheitsbild auskennen.
© JPC-PROD / fotolia.com
DÜSSELDORF. Psychotherapeuten mit einem Spezialwissen über Diabetes können einen wesentlichen Beitrag zu einer besseren Versorgung von Menschen mit der Stoffwechselerkrankung leisten. „Wir wissen, dass die diabetologisch qualifizierte Psychotherapie wirkt und gut wirkt“, sagte Professorin Karin Lange, Leiterin der Forschungs- und Lehreinheit Medizinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, bei einer Fachtagung der Psychotherapeutenkammer Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf.
Lang, die Vorsitzende des Ausschusses „Fachpsychologe/in Diabetes“ der Deutschen Diabetes Gesellschaft ist, verspricht sich angesichts der aktuellen psychodiabetologischen Unterversorgung viel von der Weiterbildung „Spezielle Psychotherapie bei Diabetes“. Sie ist seit 2017 Teil der Muster-Weiterbildungsordnung der Bundespsychotherapeutenkammer. Die Weiterbildung dauert mindestens 18 Monate und umfasst unter anderem 180 Behandlungsstunden unter Supervision, 80 Stunden theoretische Weiterbildung und 40 Stunden externe Hospitation.
Die Behandlung durch entsprechend geschulte Psychotherapeuten kann zu einer besseren somatischen Prognose und einer höheren Lebensqualität der Patienten führen, glaubt Lang. „Das wird vielen Menschen helfen, ein gutes Leben mit Diabetes zu führen.“
Eigenverantwortliche Therapie
Der Diabetes verlange von den Betroffenen ein hohes Maß an eigenverantwortlicher Therapie. „Ein zentrales Element der Diabetes-Therapie ist es, ständig über die Krankheit nachzudenken und sie zu steuern.“ Das überfordere manche Patienten und zum Teil auch die Angehörigen, gerade Familien mit Kindern und Jugendlichen mit einem Diabetes. Sie bräuchten zum Teil Hilfe beim Umgang mit der Erkrankung. „Es gibt eine hohe Problematik der Diabetes-Akzeptanz“, berichtete sie.
40 Prozent der Mütter von Kindern mit Diabetes haben nach ihren Angaben eine posttraumatische Belastungsstörung, nicht zuletzt wegen der Angst, den Sohn oder die Tochter zu verlieren. Ebenfalls 40 Prozent der Mütter hören nach der Diagnose auf zu arbeiten. „Das hat verheerende Folgen“, betonte Lang.
In der Fachwelt sei die Bedeutung der Einbeziehung von Psychotherapeuten in die Diabetes-Versorgung unbestritten. Die Leitlinien sähen die Betreuung der Patienten durch multiprofessionelle Teams vor. Ein weiterer Beleg: Bei der stationären Diabetes-Therapie fällt die DRG deutlich niedriger aus, wenn es keine multimodale Komplexbehandlung gibt.
Viele diabetesbezogene Ängste
Somatische und psychische Faktoren seien für die Behandlung des Diabetes gleichermaßen bedeutsam, bestätigte Dr. Rainer Paust, Leiter des Instituts für Psychosoziale Medizin am Elisabeth-Krankenhaus in Essen. „Die Berücksichtigung diabetesbezogener Belastungen gilt als eine zentrale Aufgabe in der Diabetesbetreuung.“ Zu diesen Belastungen zählen Depressionen, Coping- und Akzeptanzstörungen, diabetesspezifische Ängste und Essstörungen.
„Jeder zweite Diabetespatient ist aufgrund des Diabetes im Alltag belastet“, sagte Paust. 50 Prozent hätten Probleme mit der Ernährung und der Selbstbehandlung, 60 Prozent Angst vor Folgeerkrankungen und 40 Prozent Probleme mit Hypoglykämien. Er nannte weitere Beispiele für diabetesbezogene Ängste: Angst vor Kontrollverlust, Progredienz oder der Spritze, übertriebene Sorge vor einer Insulinbehandlung, Angst vor sozialen Ausgrenzungen oder vor Überforderung sowie die Angst, unangenehm aufzufallen.
Die Probleme und Belastungen stünden häufig in Zusammenhang mit der Behandlung: je komplexer die Therapie desto größer die Belastung der Patienten.
Bei der psychotherapeutischen Versorgung der Diabetiker sei es wichtig, dass sich die Therapeuten mit dem Krankheitsbild auskennen. „Patienten brauchen Psychotherapeuten mit einer speziellen Basisqualifikation.“ Viele hätten zwar schon eine Psychotherapie gemacht, der Diabetes habe dabei aber gar keine Rolle gespielt. Auch Therapeuten scheuten sich häufig, die Erkrankung anzusprechen aus Sorge, mit dem Thema nicht zurechtzukommen. „Diabeteswissen trägt zu einem besseren Verstehen von Zusammenhängen im Rahmen der Diabetestherapie und psychischen Belastungen sowie behandlungsbedürftigen Störungen bei“, so Paust.
Er empfahl den Psychotherapeuten, die in diesem Bereich tätig sind, sich ein Netzwerk aufzubauen und mit Diabetologen und Diabetesberatern zusammenzuarbeiten.