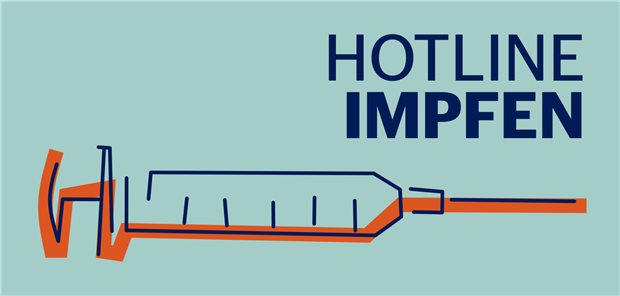Datenbankstudie
Schützt der Erholungsschlaf am Wochenende vor Demenz?
Wer an Wochentagen schlecht schläft, kann durch Ausschlafen am Wochenende möglicherweise etwas gegen das erhöhte Demenz-Risiko tun. Hinweise darauf will ein chinesisches Team nach Auswertung der UK Biobank gefunden haben. Zu viel Schlaf schien allerdings eher kontraproduktiv zu sein.
Veröffentlicht:
Diese Ergebnisse legen dem Team zufolge nahe, dass erholsamer Schlaf offenbar in der Lage sei, die negativen Effekte von Schlafentzug auf das Gehirn teilweise umzukehren. Offenbar ließen sich strukturelle und funktionelle Schäden bei einer Nachholschlafdauer von 0,77 Stunden am besten eindämmen.
© Rido / stock.adobe.com
Das Wichtigste in Kürze
Frage: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Dauer von Nachholschlaf am Wochenende und dem Risiko, an Demenz zu erkranken?
Antwort: Bei Teilnehmenden, die wochentags schlecht schliefen, war Erholungsschlaf am Wochenende mit einer reduzierten Inzidenz von Demenz, insbesondere vaskulärer Demenz assoziiert. Für Alzheimer-Demenz schien der Zusammenhang nicht zu gelten. Insgesamt schienen 8,38 Stunden unter der Woche für die Demenzprävention die optimale Schlafdauer zu sein.
Bedeutung: Die Daten legen nahe, dass Nachholschlaf am Wochenende bei schlechten Schläfern und Schläferinnen dazu beitragen könnte, das erhöhte Demenzrisiko zu senken.
Einschränkung: Datenbankstudie; keine Differenzierung zwischen nächtlichem Schlaf und Nickerchen tagsüber; keine detaillierten Informationen zu Schlafqualität und Schlafarchitektur; Kausalzusammenhang zwischen Schlafmangel und Demenz nicht belegt.
Peking. Schlechter Schlaf wurde bereits in mehreren Studien mit einem erhöhten Demenzrisiko assoziiert. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass das Risiko bei weniger als sechs Stunden pro Nacht um etwa ein Drittel ansteigt, bei weniger als fünf Stunden sollen es sogar bis zu 45 Prozent sein.
Allerdings gelingt es sehr vielen Menschen zumindest während der Arbeitswoche nicht, auf die propagierte Schlafdauer von mindestens sieben Stunden Schlaf zu kommen; sie versuchen dann, am Wochenende Schlaf nachzuholen.
Wie sich das auf die Inzidenz verschiedener Demenzformen auswirkt, hat ein chinesisches Forschungsteam anhand der UK Biobank untersucht (J Neurol 2025; online 5. September).
Studie mit über 88.000 Teilnehmenden
An der Studie nahmen insgesamt 88.592 Personen teil, die zu Beginn keinerlei Anzeichen einer Demenz und zumindest kein extrem auffälliges Schlafverhalten aufwiesen (durchschnittliche Schlafdauer an Wochentagen nicht unter drei und nicht über 14 Stunden). Das mediane Alter zu Studienbeginn lag bei 62 Jahren, 57 Prozent waren weiblich.
Nachbeobachtet wurde über median 6,8 Jahre. In diesem Zeitraum entwickelten 735 Personen (0,83 Prozent) eine Demenz, davon 308 eine Alzheimer-Demenz (AD), 137 eine vaskuläre Demenz (VaD) und 319 eine nicht näher spezifizierte Demenzerkrankung.
Gut acht Stunden pro Tag angeblich „optimal“
Nach Bo Zhao von der Capital Medical University in Peking und seinem Team war das Demenzrisiko insgesamt am niedrigsten bei einer Schlafdauer an Wochentagen von median 8,38 Stunden täglich (Hazard Ratio, HR 0,73).
Für die AD-Prävention schienen 8,33 Stunden Schlaf optimal zu sein (HR 0,72), zur Vermeidung einer vaskulären Demenz 9,07 Stunden (HR 0,59).
Die Durchschnittsschlafdauer für alle Teilnehmenden lag bei 8,68 Stunden. An den Wochenenden kamen im Schnitt noch einmal 0,56 Stunden täglich dazu. Von denjenigen, die eine Demenz entwickelt hatten, hatten 299 eine „suboptimale“ Schlafdauer, sie schliefen also kürzer als der Durchschnitt.
In dieser Gruppe betrug die Schlafdauer an Wochentagen median 7,49 Stunden, an Wochenenden waren es lediglich 0,36 Stunden pro Tag mehr.
Dagegen kamen suboptimale Schläfer ohne Demenz auf eine Schlafdauer von median 7,61 Stunden pro Nacht unter der Woche und ein Nachholpensum von immerhin 0,91 Stunden am Wochenende.
Erholungsschlaf mit geringerem Demenzrisiko assoziiert
Bei den suboptimal Schlafenden war ein verlängerter Schlaf am Wochenende mit einem signifikant geringeren Risiko für Demenz jeglicher Ursache (HR 0,80; p < 0,001), für VaD (0,75; p = 0,004) sowie für nichtspezifizierte Demenz (HR 0,78; p = 0,001) assoziiert, nicht dagegen für AD.
Mithilfe von MRT-Untersuchungen maßen Zhao et al. die Volumina bestimmter Hirnstrukturen. Bezogen auf das Gesamtvolumen der grauen Substanz ließ sich ein Optimum feststellen, und zwar bei einer Schlafdauer an Wochentagen von median 7,73 Stunden.
Auch hier machte sich ein Nachholeffekt bemerkbar: In der Gruppe mit suboptimaler Schlafdauer waren die Volumina von subkortikaler grauer Substanz und linkem Hippocampus am größten bei einer Dauer des Nachholschlafs von median 1,16 Stunden.
Das Volumen des rechten Hippocampus war am größten bei 1,26 Stunden und das Volumen der weißen Substanz in der rechten Hirnhälfte bei 0,4 Stunden.
Auch auf kognitive Funktionen hatte der Nachholschlaf laut Zhao und Kollegen einen Effekt. Dies zeigte sich vor allem im Ziffernsymbol-Substitutionstest (DSST) (optimale Performance bei zusätzlichen 1,9 Stunden).
Reicht eine Dreiviertelstunde länger?
Diese Ergebnisse legen dem Team zufolge nahe, dass erholsamer Schlaf offenbar in der Lage sei, die negativen Effekte von Schlafentzug auf das Gehirn teilweise umzukehren. Offenbar ließen sich strukturelle und funktionelle Schäden bei einer Nachholschlafdauer von 0,77 Stunden am besten eindämmen.
Bemerkenswerterweise war der Effekt des Nachholschlafs bei Männern ausgeprägter als bei Frauen (HR 0,81) und bei Personen über 60 Jahren stärker als bei Jüngeren (HR 0,76).
Bei Männern jedoch, die wochentags genug schliefen, war Nachholschlaf am Wochenende sogar mit einem erhöhten Demenzrisiko assoziiert.
Effekt vor allem auf Gefäße
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass Erholungsschlaf am Wochenende bei Menschen, die unter der Woche zu wenig schlafen, mit einer Reduktion des erhöhten Demenzrisikos assoziiert ist“, fassen Zhao und sein Team zusammen.
Dabei scheine der zusätzliche Schlaf vor allem zur Reparatur vaskulärer Schäden beizutragen. Auf die Beta-Amyloid-Clearance, entscheidend für den Schutz vor AD, habe das Ausschlafen am Wochenende dagegen offenbar wenig Einfluss, so die Interpretation der Forschenden.
Das Team warnt allerdings vor Exzessen: So könnten stark unterschiedliche Schlafzeiten den zirkadianen Rhythmus durcheinanderbringen, was nicht nur das Risiko für Diabetes, Bluthochdruck und Adipositas erhöhe, sondern auch neurodegenerative Prozesse begünstigen könne.
Auch insgesamt zu viel Schlaf sei möglicherweise schädlich: Wer trotz ausreichend Schlaf an Wochentagen am Wochenende nochmal extra lang schlafe, müsse sogar mit einem erhöhten Risiko, an Demenz zu erkranken, rechnen.