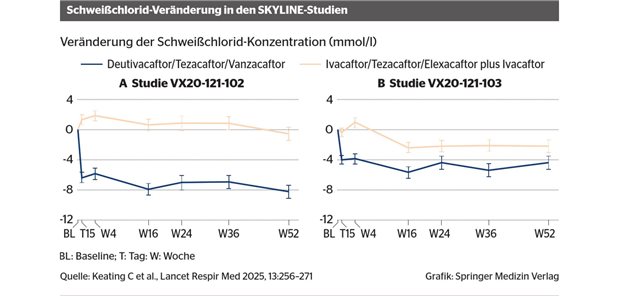Patientenbefragung
Sensorische Störungen bei SARS-CoV-2-Infektion unterschätzt
Bei der Differenzialdiagnose einer SARS-CoV-2-Infektion wird das Symptom einer Riech- und Geschmacksstörung noch unterschätzt, betonen italienische Ärzte.
Veröffentlicht:
Bei der Befragung italienischer COVID-19-Patienten gab jeder fünfte an, schon vor dem Klinikaufenthalt sensorische Störungen bemerkt zu haben.
© Marco Passaro/IPA/ABACAPRESS.COM/dpa
Mailand. Bei einer Befragung von 59 Patienten im Uniklinikum Mailand gaben 34 Prozent entweder eine Störung des Geruchssinns oder eine Störung des Geschmackssinns an, 19 Prozent sogar beides (Clin Inf Dis 2020; online 26. März). Riech- und Geschmacksstörungen sind den behandelnden Ärzten zufolge daher ein bisher unterschätztes Symptom einer SARS-CoV-2-Infektion. Auch bei einer Befragung deutscher Patienten aus Heinsberg hatten zwei Drittel von derartigen Symptomen berichtet.
Hilfreich bei Differenzialdiagnose?
Die sensorischen Störungen seien dabei häufig schon vor der Einlieferung in eine Klinik aufgetreten (20,3 Prozent), bei 13,5 Prozent erst im Laufe des Krankenhausaufenthaltes, berichten die Mailänder Ärzte um Dr. Andrea Giacomelli. Bemerkenswert dabei: Geschmacksstörungen bemerkten 91 Prozent der Patienten schon, bevor sie in eine Klinik kamen. „Riech- und Geschmacksstörungen könnten daher bei der Differenzialdiagnose hilfreich sein und gerade bei Personen, die sonst asymptomatisch sind, eine Orientierungshilfe darstellen.“
Auffällig war den Ärzten zufolge auch, dass Patienten, die entweder über eine Geschmacksstörung oder eine Riechstörung berichteten, im Mittel jünger waren und häufiger Frauen. Die Symptome waren bis zum Zeitpunkt der Befragung nicht verschwunden.
Viel ACE-2 in der Mundschleimhaut
Als Ursache könnten mehrere Faktoren zusammenspielen: So sei etwa von SARS-CoV-1 aus dem Jahr 2002/2003 bekannt, dass es in Mäusen über den Bulbus olfactorius ins Gehirn gelangt (J Virol 2008; 82(15): 7264–7275). Zudem binde das neue Coronavirus SARS-CoV-2 über ACE-2 an seine Zielzellen. Dieses Protein sei besonders stark auf den Epithelzellen der Mundschleimhaut exprimiert, erinnern Giacomelli und Kollegen.