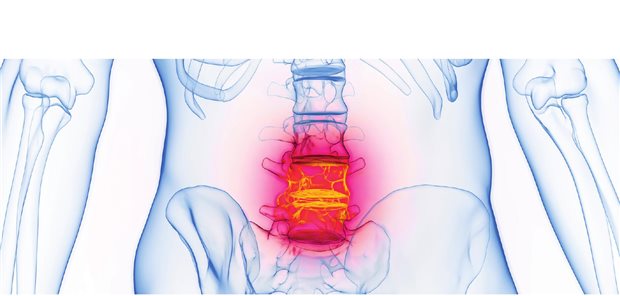Rudolf-Schoen-Preis
Was haben Haut- und Darmbakterien mit Lupus zu tun?
Für Forschungen zu möglichen Auslösern des systemischen Lupus erythematodes wurde jetzt der Rudolf-Schoen-Preis verliehen.
Veröffentlicht:DRESDEN. Bakterien, die über den Darm in die Leber eindringen, könnten an der Entwicklung einer krankhaften Abwehrreaktion des Immunsystems gegen körpereigene Gewebe beteiligt sein. Auslöser des systemischen Lupus erythematodes (SLE) etwa könnten Darmbakterien sein, die körpereigenen Strukturen ähneln, heißt es in einer Mitteilung zum 47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie e. V. (DGRh) in Dresden.
Für die Forschung an diesen Vorgängen hat die Stiftung der DGRh in diesem Jahr Dr. Martin Kriegel aus Riehen, Schweiz, mit dem Rudolf-Schoen-Preis ausgezeichnet. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.
Beim systemischen Lupus erythematodes greift das Immunsystem Gewebe und Organe im eigenen Körper an und ruft eine Entzündungsreaktion hervor. Ins Visier dieser fehlgeleiteten Abwehr geraten vor allem die Gelenke, die Niere und die Haut. Betroffen sind meist Frauen im gebärfähigen Alter. Sie leiden unter rheumaartigen Schmerzen, oft mit Fieber verbunden.
Im Gesicht betroffener Patienten kommt es zu der für die Krankheit typischen schmetterlingsförmigen Rötung, auf dem Kopf zu Haarausfall, im Mund zu schmerzhaften Geschwüren. Angegriffen werden aber auch lebenswichtige Organe wie das Herz.
Früher endete die Erkrankung oft tödlich. Heute leben die meisten Patienten dank Medikamenten, die die Angriffslust des Immunsystems dämpfen, einen weitgehend normalen Alltag.
Immunreaktion durch eine „Verwechslung“
Für SLE typische Antikörper sind Autoantikörper, die sich gegen das Antigen „Ro60“ richten – Ro60 ist im Prinzip eine harmlose Zellstruktur im Körper. Weshalb diese Autoantikörper entstehen, ist nicht bekannt. Forschungen von Kriegel deuten auf eine Beteiligung von Haut- und Darmbakterien hin.
Ursächlich für die Immunreaktion ist vermutlich eine Verwechslung: Die Antikörper, mit denen das Immunsystem die Organe angreift, sind eigentlich gegen Ro60 gerichtet, das bei einigen Bakterien im Darm, aber auch im Mund und auf der Haut vorkommt.
Der Rheumatologe konnte bisher zeigen, dass das Darmbakterium Enterococcus gallinarum bei anfälligen Menschen in die Leber eindringt. Dort könnten also Immunreaktionen ihren Anfang nehmen, um schließlich den gesamten Körper zu erfassen.
Erste Impferfolge
Bei Mäusen konnte Kriegel den Ausbruch einer SLE-artigen Erkrankung durch einen Impfstoff gegen dieses Bakterium verhindern. „Ob Impfungen oder andere gezielte Behandlungsansätze gegen Darmmikroben in der Zukunft neue Therapiemöglichkeiten für Patienten mit Rheuma darstellen, muss noch intensiv untersucht werden, könnte aber aufgrund unserer Ergebnisse vorstellbar sein“ wird Kriegel in der Mitteilung zitiert.
Aktuell untersucht Kriegel, ob eine Ernährungstherapie den Ausbruch der Erkrankung verhindern könnte. Auffällig ist, dass die Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten in den westlichen Ländern mit einer starken Zunahme der SLE- und anderer Autoimmunerkrankungen einhergehen. Ein Mangel an Ballaststoffen könnte dazu geführt haben, dass harmlose Bakterien sich so stark vermehren, dass sie zu „Pathobionten“ werden. Ein solcher „Pathobiont“ könnte Lactobacillus reuteri sein, der auch im Darm von einigen Patienten mit SLE vermehrt vorkommt.
In einer neuen Publikation zeigt Kriegel, dass bei Mäusen eine Diät mit einer Art von Ballaststoffen verhindern kann, dass diese Bakterien durch die Darmwand dringen und die Immunreaktion verstärken, die dann zum SLE führt (Cell Host & Microbe 2019; 25: 1-15). Ob eine Ernährungsumstellung auch beim Menschen wirksam wäre, wurde bisher noch nicht untersucht. (eb)