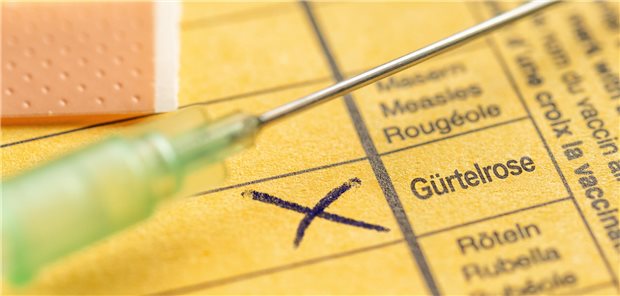EvidenzUpdate-Podcast
Methodische Frühlingsgefühle – oder warum Leitlinien ein bisschen Liebe brauchen
Liebhaberei oder Leitplanke? Wir sprechen darüber, wie sich Fachgesellschaften bei der NVL KHK in die Haare geraten – und was das mit Paartherapie, Methodensport und Living Guidelines zu tun hat. Teil 2 des EvidenzUpdate-Doppels über Grundsatzfragen der Leitlinienarbeit.
Veröffentlicht:
Im zweiten Teil der Doppelfolge zur Nationalen VersorgungsLeitlinie (NVL) Chronische KHK werfen wir einen Blick hinter die Kulissen der Leitlinienarbeit – und in die Konflikte. Nachdem wir in Teil 1 die kardiologische Kritik an der NVL Version 7 besprochen haben, geht es in Episode 138 um die Grundsatzfragen: Wie entstehen Leitlinien? Wer hat das Sagen? Was passiert, wenn Fachgesellschaften sich zurückziehen – und ist das eigentlich noch kollegial oder schon destruktiv?
EvidenzUpdate-Podcast
Die NVL Chronische KHK unter Beschuss – was steckt hinter der Kritik?
Was auf den ersten Blick wie eine methodische Auseinandersetzung wirkt, ist oft ein Ringen um Deutungshoheit, Gewichtung von Evidenz und darüber, Standards zu setzen. Die Kritik der Kardiolog:innen ist für Scherer vielfach nachvollziehbar – aber eben nicht abschließend. Viele der zitierten Studien seien durchaus bekannt gewesen und bereits im NVL-Prozess diskutiert worden. Der Unterschied liege im Umgang mit der Evidenz: Welche Studien ziehe ich heran, wie gewichte ich sie – und vor allem: für welches Setting gelten sie überhaupt?
An dieser Stelle wird es grundsätzlich – und auch ein wenig philosophisch. „Ist das nicht manchmal auch einfach Liebhaberei?“ – die Liebe zum eigenen Score, zur vertrauten Methode? Scherer: „Jeder bringt seine immateriellen Interessenskonflikte mit.“ Es sei menschlich, an Bewährtem festzuhalten. Doch genau deshalb brauche es klare Strukturen, konsentierte Fragestellungen (PICO!) und methodische Disziplin in der Leitlinienarbeit. Nur so ließen sich persönliche Vorlieben zurückstellen und gemeinsam getragene Empfehlungen erarbeiten. „Es geht nicht darum, wer den Methodensport gewinnt“, sagt Scherer, „sondern darum, die richtigen Patient:innen zur richtigen Zeit mit der richtigen Diagnostik zu versorgen.“
Deutlich kritischer fällt sein Blick auf das Vorgehen der kardiologischen Fachgesellschaften aus. Dass sie sich nachträglich öffentlich aus dem NVL-Prozess zurückziehen und ihre Kritik in einem Fachjournal platzieren, sei ein „historischer Vorgang“ – leider im negativen Sinne. Leitlinienarbeit sei kein Wunschkonzert, sondern ein strukturierter Prozess mit klaren Spielregeln. Wer Teil davon sei, trage auch Verantwortung für das Ergebnis – nicht erst nachher, sondern währenddessen. „Rückzugsrhetorik“, so Scherer, untergrabe diese Verantwortung. Es brauche nicht weniger, sondern mehr Gespräch, mehr Diskurs – auch mit Dissens, aber im richtigen Rahmen.
Was also tun, wenn das Gespräch stockt? Die Podcast-Episode ist „eine Art hörbarer Leserbrief an die Kardiologie“. Auch wenn das Gespräch momentan stockt, plädiert Scherer dafür, die Kommunikationsfäden wieder aufzunehmen. Dass es gelingen kann, zeigt das Beispiel der Diabetes-Leitlinien, in denen Dissens offen benannt und dennoch gemeinsam bearbeitet wurde. „Wir müssen nicht Best Friends werden“, sagt Scherer, „aber wir müssen miteinander reden – und nicht übereinander.“
Der Blick nach vorn: Die Auseinandersetzung rund um die NVL KHK zeigt nicht nur, wie konfliktanfällig der Prozess sein kann – sondern auch, dass Leitlinien agiler und aktueller werden müssen. Der Weg dahin: Living Guidelines, also Leitlinien, die kontinuierlich aktualisiert werden, ohne jedes Mal zur Mammutaufgabe zu werden. Doch auch das, so Scherer, brauche klare Strukturen und Ressourcen – sonst drohe der „Flickenteppich“.
Und es geht nicht um gegenseitiges Bashing, sondern um einen ehrlichen, konstruktiven Blick auf das, was in der Leitlinienarbeit gut läuft – und was besser werden muss. Mit Selbstreflexion, methodischer Klarheit und einem ungebrochenen Wunsch, die Versorgungsqualität zu verbessern. Oder wie Martin Scherer es formuliert: „Das NVL-Projekt ist kein Projekt einzelner Personen. Es ist ein demokratischer Akt der Selbstverpflichtung zur besseren Medizin.“ (Dauer: 45:40 Minuten)
Anregungen? Kritik? Wünsche?
Schreiben Sie uns: podcast@evidenzupdate.de
Literatur
... gibt es in den Shownotes von Teil 1 des Gesprächs.
Transkript
Nößler: Zeitenwende, die Zweite, und zwar Kardio und vaskulär. In der letzten Episode, Teil 1 unseres Gesprächs, haben wir über die kardiologische Kritik an der NVL KHK gesprochen, und zwar sehr lange. Jetzt kommt Teil 2, der ist vielleicht etwas kürzer. Und in dem wollen wir über die Metaphysik von Leitlinienarbeit sprechen über die Dialektik der medizinischen Wissenschaft. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode des EvidenzUpdate-Podcast. Wir, das sind ...
Scherer: Martin Scherer.
Nößler: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Denis Nößler. Mahlzeit, Herr Scherer!
Scherer: Mahlzeit, Herr Nößler! Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist und ob es überhaupt Zeit für ein Mahl ist.
Nößler: Bald wieder. Es ist eigentlich bald Abend. Es ist 17:19 Uhr. Wir sind immer noch in Köln, am Freitag, den 9. Mai, immer noch Frühjahrstagung. Parallel läuft noch die Delegiertenversammlung. Und wir haben das Hotel gewechselt.
Scherer: Genau. Und wir sehen den Kölner Dom nicht, sehen den Rhein nicht, weil Sie die Vorhänge zugezogen haben.
Nößler: Schallschutzgründe.
Scherer: Weil es sonst angeblich hallt in diesem Zimmer.
Nößler: So ist das. Wir hatten es angedroht, dass wir das superlange Gespräch, das dann doch sehr lang geworden ist, teilen wollen, haben wir jetzt auch gemacht. Deswegen diese zweite Episode. Für uns ist es derselbe Tag. Die Hörerinnen und Hörer können es eh hören, wann sie wollen. Wollen Sie vielleicht noch mal für alle, die jetzt einsteigen und die erste Episode noch gar nicht mitbekommen haben, aber den ersten Teil vielleicht ganz kurz vielleicht in ein paar wenigen Sätzen diese zwei Stunden versuchen zusammenzufassen?
Scherer: Das ist ja mal wieder prima. Vielen Dank, Herr Nößler, dafür. Aber dennoch würde ich unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, zumindest noch mal das Transkript zu überfliegen, und sei es nur die Zusammenfassung des letzten Gesprächs, sonst ist man in dieser Episode – ich würde nicht sagen lost, aber es fehlt hier und da vielleicht der Bezug. Obwohl ich in meinen Antworten oder im Gespräch immer wieder versuche, Dinge aufzugreifen. Also worüber haben wir gesprochen? Wir haben über die Kritik der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie gesprochen, an der nationalen Versorgungsleitline KHK publiziert ...
Nößler: Die sind da ausgestiegen.
Scherer: Richtig, die Kardiologen sind da ausgestiegen oder nicht nur die Deutsche Gesellschaft Kardiologie ist da ausgestiegen, sondern auch die DGIM in toto und die DGPR. Und die wissenschaftliche Untermalung oder die inhaltliche Begründung, die findet sich wo, Herr Nößler?
Nößler: In den Shownotes.
Scherer: In den Shownotes. Und ist wo publiziert?
Nößler: Die ist publiziert in der Zeitschrift „Die Kardiologie“. Und die haben wir, Herr Scherer, wo?
Scherer: In den Shownotes. Und das ist das, was wir praktisch in der letzten Episode gemacht haben. Ich sage auch dazu, das war für mich wirklich anstrengend. Ich will mich hier nicht beklagen, aber wir haben darüber gesprochen über das Opinion Paper in der Zeitschrift „Die Kardiologie“, wir haben über die NVL gesprochen, wir haben über die Leitlinie Brustschmerz gesprochen. Dann in den Shownotes, ich weiß nicht, wie viel Papers sich darin finden ...
Nößler: Ich glaube 36.
Scherer: Wir haben zur Vorbereitung uns diese 36 Papers angeguckt. Letztlich haben Sie zwei Studienideen präsentiert, wovon drei Studienideen ...
Nößler: Eine ist aber bei Ihnen durchgefallen.
Scherer: Eine ist durchgefallen. Also entweder Sie machen noch Ihren Doktor oder kriegen den Doktor h.c. zumindest für die gemeinsame Vorbereitung der letzten Episode. Und das haben wir versucht, in drei Themenschwerpunkten dann zu kondensieren. Der eine war CABG versus PCI, also Coronary Artery Bypass Grafting, die Bypass-OP gegen die perkutane Intervention. Das Zweite war das Thema Lipide und das Dritte war das Thema der Scores und der Prädiktionsmodelle. Beim Thema Bypassoperation versus PCI haben wir uns mit der Kritik auseinandergesetzt, dass manche Literaturstellen in der NVL veraltet seien. Da waren auch bestimmte Punkte, auf die man eingehen musste. Das Thema Drug-Eluting Stents, die in verschiedenen Generationen über die Zeit hinweg sich weiterentwickelt haben. Dann bestimmte Arbeiten, die zum Publikationszeitpunkt der NVL noch nicht vorlagen. Und letztlich hatten wir auch eine Endpunktdiskussion, die IPD von Head et al. versus einer anderen Arbeit, die auch in dem Kardiologie-Paper zitiert wird, wo es sich aber wieder um ein bisschen andere Endpunkte handelte und auch eine andere Patientenpopulation, nämlich Patienten mit Hauptstammstenose. Das heißt, im Grunde genommen ging es in diesem ersten Teil sehr stark um den Vergleich dieser zwei Revaskularisationsinterventionen und um unterschiedliche Endpunkte und unterschiedliche Patientenpopulation. Und glauben Sie, wenn ich das so sagen darf, auch um das Problem der selektiven Gewichtung von Evidenz.
Nößler: Genau, dass ich nur heranziehe, was jetzt meinem Argument dienlich ist. Und ich glaube, bei der Endpunktgeschichte war auch ein Aspekt, wenn ich mich richtig erinnere, ob eine Studie für einen primären Endpunkt sinnvoll gepowert ist oder ob ich eine Post-hoc-Auswertung mache zu Endpunkten, wofür die Studie gar nicht gepowert ist.
Scherer: Richtig. Im zweiten Teil ging es dann um diese zwei Strategien der Lipidsenkung TTT versus FAG, Treat-to-Target and Fire and Forget, also FaF.
Nößler: Also auf Deutsch: Hochdosisstatintherapie.
Scherer: Hochdosisstatintherapie zielwertorientiert versus Strategie der fixen Dosis. Und an diesem Beispiel habe ich versucht zu erläutern, dass diese Thematik weit größer ist als die Zahl 55 mg/dl LDL.
Nößler: Beziehungsweise 1,4 ...
Scherer: 1,4 mmol/l. Und die Thematik ist weit größer als solche Laborkennzahlen, weil es hier nicht nur um Lipidkosmetik geht oder Statinologie, sondern es geht letztendlich um bevölkerungsmedizinische Ansätze und um Strategien der Bevölkerungsgesundheit. Es sind dann auch verschiedene Studiennamen gefallen: FOURIER, ODYSSEY OUTCOMES, IMPROVE-IT und letztlich auch die LODESTAR-Studie, die diese zwei Strategien verglichen hat, aber keine Unterlegenheit der fixen Dosis zeigen konnte. Und da hatten sie auch die Studienidee, dass man eine solche Fragestellung vielleicht noch mal in einem hausärztlichen primärärztlichen Forschungsverbund, in einer hausärztlichen Forschungsnetzwerkinfrastruktur erproben könnte, prospektiv. Dazu wird es sich dann die DESAM ForNet eignen beziehungsweise jetzt mit neuem Namen und in neuer Förderperiode DEGAM ForNet. Der dritte Bereich war der der Scores. Da haben wir natürlich über den Marburger Herz-Score gesprochen, die Kritik am Marburger Herz-Score. Wir haben noch mal deutlich gemacht, wofür der eigentlich da ist, nämlich bei stabiler KHK auch validiert an einer Population mit stabiler KHK entsprechende Vorhersagen zu treffen und eben nicht im Hinblick auf ACS, akutes Koronarsyndrom. Da gibt es dann auch spezialisiertere Scores, wie den risk factor clinical likelihood score vonseiten der Kardiologie. Der für einen anderen Settingbereich gedacht ist, für eine andere Population gedacht ist. Und wir haben in diesem Zusammenhang auch das Thema des Spektrumbiases besprochen und die Notwendigkeit settingspezifischer Ansätze und der Konzentration auf bestimmte Populationen.
Nößler: Weil die in einem Kollektiv bei Kranken beziehungsweise bereits Diagnostizierten entwickelt wurden und deswegen nicht in das Setting „ich weiß noch gar nicht, was du hast“ passen. Und wir haben über Dyspnoe gesprochen. Weil die Kardiologen die gerne auch mit als Risikofaktor hätten, als so atypisches Angina pectoris Äquivalent. Und da hatte ich eine Forschungsfrage formuliert, die ist bei Ihnen durchgefallen. Ich glaube, die Forschungsfrage lautete so: Man könnte doch mal schauen, ob man den Marburger Herz-Score noch mal weiter validiert unter Hinzunahme der Dyspnoe, um herauszufinden, ob die ein valider Prädiktor sein kann – ja/nein. Und da haben Sie gesagt, das interessiert Sie eigentlich nicht so primär.
Scherer: Nein, so ist es nicht. Es hat sich die Dyspnoe einfach nicht als relevanter Risikofaktor in dieser Population erwiesen. Also das gibt es eigentlich schon.
Nößler: Und nach all diesen kleinen Details, also das war jetzt dieser Versuch, in guten zehn Minuten zwei Stunden zusammenzufassen, alle, die uns hier an der Stelle zuhören, sehen es uns nach, dass wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Sie haben es gesagt, Martin Scherer, in jedem Fall der Hörtipp, sich Teil dieses Gesprächs anzuhören, also die Episode davor.
Scherer: Aber eine Sache vielleicht noch als Brückenschlag zu dieser jetzigen Episode: Was sich durchgezogen hat wie ein roter Faden, das war das Thema: Wie greife ich mir bestimmte Evidenz-Pieces, wie interpretiere ich sie, wie ordne ich sie ein in einen klinischen Versorgungskontext. Und da sind wir eigentlich dabei gelandet: Ja, es kann unterschiedliche Perspektiven geben, die katalogische Perspektive ist eine andere als die hausärztliche. Aber was ist eigentlich die Plattform, auf der man systematisch mit solchen Fragestellungen oder Problemen umgeht, mit solchen methodischen Problemen umgeht. Und das war eigentlich der Cliffhanger.
Nößler: Das war der entscheidende Cliffhanger. Und was uns bei dem Gespräch auch aufgefallen ist – und das kann man dann nachhören beziehungsweise man kann es vor dem Transkript nachlesen, weil wir da unsere eigene Literatur zusammengefasst haben, die wir herangezogen haben zum Besprechen – das Paper der DGK in „Die Kardiologie“ hat um die 50 Endnoten gehabt. Geben Sie mal eine Schätzung ab, wie viele Endnoten die NVL KHK hat? Vielleicht haben Sie es sogar aufs Komma genau.
Scherer: 380.
Nößler: Fast perfekt. 408. Also das ist einfach mal ein Faktor fast mal zehn. Und was uns im Gespräch oft aufgefallen ist, Martin Scherer, dass die Arbeiten, die die Kardiologen angeführt haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen – Arbeiten, die 2024 erschienen sind – alle von der NVL-Autorengruppe besprochen wurden. Also Fazit an der Stelle: Großes Problem bei Evidenzeinordnung vulgo Leitlinienerstellung ist Selektion. Und dafür braucht es eine Methode. Und Sie haben die Cliffhanger-Frage noch mal formuliert, die Sie initial gestellt haben: Was ist die Plattform, wo wir dieses Gespräch führen? Weil jetzt machen wir gerade Folgendes: Wir machen ein Podcast-Gespräch über die Kritik eines anderen Fachgebiets, die in einem Journal publiziert wurde auf Basis einer NVL, die auf der AWMF-Webseite publiziert wurde im August.
Scherer: Von hinten durch die Brust ins Auge, könnte man fast sagen.
Nößler: Und wer weiß, wo wir da noch landen. Es sind ja Umwege möglich. Cliffhanger-Frage ist formuliert. Eine Sache interessiert mich aber noch vorab, Herr Scherer. Das ist mir nämlich aufgefallen relativ früh beim Lesen der Dokumente. Ich sagte es im letzten Gespräch auch, dass hier und da für mich Etliches plausibel klang, was die Kardiologen gesagt haben und man das Gefühl hatte, irgendwie haben doch beide recht. Und kann es nicht sein, wenn man auch über dieses ganze Thema Leitlinien Metaphysik spricht, wo dann immer auch verschiedene Sichtweisen zwangsläufig kollidieren müssen, in dem Fall hochspezialistische Versorgung mit niedrigprävalenter Versorgung, das ist der rote Faden unseres Podcast. Der Streit um den richtigen Score, hatten Sie zuletzt, Marburger Herz-Score versus die Modelle, in die die Kardiologen verliebt sind. Ist da nicht – jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, ganz offen und ehrlich – manchmal auch so eine jeweilige Liebhaberei vorhanden? Mein heiliger MHS, mein heiliges RF-CL? Und stehen nicht auch diese liebgewonnen Dinge, an denen man doch so gerne festhält – man hat sie mit viel Schweiß validiert und entwickelt – steht auch nicht manchmal so eine Liebhaberei einer vielleicht sinnvollen Weiterentwicklung im Weg?
Scherer: Es klingt jetzt schon fast ein wenig nach Leitlinien Paartherapie. Sie beschwören sozusagen methodische Frühlingsgefühle hier herauf.
Nößler: Ja, es ist Mai.
Scherer: Und es ist sonnig warm hier in Köln. Wie gesagt, wir sehen nichts wegen des Vorhangs. Auf jeden Fall, da ist schon etwas dran. Jeder bringt sein Erfahrungswissen mit, jeder bringt seine Methodenkultur mit. Jeder bringt seine immateriellen Interessenskonflikte mit. Im Grunde genommen haben Sie gerade immaterielle Interessenskonflikte beschrieben. Und es ist total menschlich, an vertrauten Modellen festzuhalten, zumal gerade dann, wenn sie sich in einem bestimmten Setting bewährt haben. Und genau deshalb brauchen wir in der Leitlinienarbeit strukturierte, methodisch saubere Verfahren, in denen nicht die persönlichen Vorlieben – Sie nennen es Liebhabereien – entscheiden, sondern präzise, klar definierte und übrigens in der Gruppe konsentierte PICO-Fragen, systematische Evidenzbewertung und dann die gemeinsame Konsensfindung. Und wenn wir mal ehrlich sind, Herr Nößler, es wäre überhaupt kein Problem, verschiedene Score-Modelle wie den Marburger Herz-Score oder den Risk factor-weighted clinical likelihood model Score nebeneinander in einer Leitlinie abzubilden mit klarem Settingbezug und genau zu sagen, wofür er da ist und wofür nicht und wo die Limitationen sind. Aber dafür muss man eben die Bereitschaft mitbringen. Man darf das eigene Modell nicht absolut setzen, sondern als eines von mehreren validen Werkzeugen begreifen. Und wenn man schon bei Leitlinien Paartherapie und Frühlingsgefühlen sind, so funktioniert es ja in der Beziehung auch, dass man das eigene nicht absolut setzt, dass man sich in den anderen reinversetzt und sich gegenseitig zuhört. Also am Ende, Herr Nößler, geht es nicht um Sieg oder Niederlage eines Scores.
Nößler: Das heißt, Primärmedizin und kardiologische Medizin haben eine Beziehungskrise.
Scherer: Sagen wir mal so: Es besteht hier eine Indikation für Beziehungsarbeit. Und nicht, damit jetzt einer von uns den Methodensport gewinnt oder dass irgendein bestimmter Score jetzt gewinnt. Um Sieg oder Niederlage geht es hier eben nicht. Sondern es geht um die Patienten. Und es geht darum, die richtigen Patienten zur richtigen Zeit der richtigen Diagnostik zuzuführen. Alles andere ist Methodengymnastik Evidenzsport.
Nößler: Bei der Zielbeschreibung, die Sie gerade gemacht haben, würde wahrscheinlich jedes Fachgebiet mitgehen. Nicht nur die kardiologischen, auch die Laborärzte zum Beispiel, würden wahrscheinlich alle sagen: Ja, genau, es geht um die Patienten. Und jetzt kommt aber die große Methodenfrage. Und Sie haben den Cliffhanger formuliert. Sie haben im Prinzip schon mehrfach gesagt, der NVL-Prozess, genauso wie jeder S3-Leitlinien-Genese-Prozess folgt sehr klaren, auf globaler Ebene verständigten Strukturen und Vorgangsweisen. Und es gibt die Kritik – das darf man an der Stelle sagen, wir machen hier Kardiologen-Bashing, das muss man vielleicht auch oft genug wiederholen.
Scherer: Ich habe jetzt mit dem Kopf geschüttelt, ich weiß nicht, ob die Zuhörer das gehört haben.
Nößler: Herr Scherer hat mit dem Kopf geschüttelt und damit hat er mir zugestimmt.
Scherer: Genau.
Nößler: Das ist auch gut, dass die Leute es nicht gesehen haben. Das hätte wiederum verwirrend sein können. Also doppelte Zustimmung an der Stelle. Es geht hier nicht um Fachgebiets-Bashing, im Gegenteil, es geht um den Versuch einer Verständigung. Und es gibt durchaus – das gehört auch mit dazu – die Kritik anderer Fachgebiete an den kardiologischen Leitlinien, wo gesagt wird: Moment, die Genese dieser ESC-Leitlinien folgt nicht den strengen Prinzipien wie man sie von der NVL von der S3-Leitlinie kennt. Sondern oftmals, das sagen Kardiologen selbst, von einem Konsensus-Statements. Aber dann teilweise auch 300 Seiten lang. Jetzt kommen wir aber mal zu genau dieser Methode und Struktur. Sie haben schon gesagt. Am Ende sitzen an so einem Tisch verschiedene Teile einer Partnerschaft zusammen, die in der Regel mehr als zwei sind. Und die müssen streiten. Und dafür braucht es diese Methode und Struktur. Und jetzt machen wir hier in diesem Podcast etwas, was ungewöhnlich ist. Es gibt eine NVL KHK Version 7.0. Die ist im August auf awmf.org veröffentlicht worden. Dann ziehen sich DGK, DEGEM, DGPR aus der Herausgeberschaft zurück, veröffentlichen in einem deutschen wissenschaftlichen Journal eine Kritik an dieser Arbeit, an der sie selbst beteiligt waren. Dann kommen wir, machen Podcast und befassen uns mit der Kritik. Jetzt könnte man sagen: Ist doch super, da verständigen sich welche über Umwege.
Scherer: Also erst mal Hut ab vor Ihrem Reflexionsvermögen. Das ist Metaebene next Level. Das ist sozusagen die Reflexion der Reflexion.
Nößler: Und jetzt müssen wir aufpassen, dass uns das nicht noch irgendwie in Abwege und irgendwelche Kaninchenbaustrukturen hineinführt. Ich zitiere aus der Replik der DEGAM auf das Paper der Kardiologen. Da stehen folgende zwei Sätze drin: „Es stellt sich die Frage, warum die kardiologischen Vertreterinnen und Vertreter nicht im Leitlinienprozess auf eine stärkere Berücksichtigung der geäußerten Kritik gedrängt haben.“ Ein Zitat. Noch mal zur Information: DGK, DGIM sind in der NVL-Gruppe dabei gewesen. Zweites Zitat der DEGAM: „Dass wissenschaftliche Ergebnisse und Studien unterschiedlich interpretiert werden, liegt in er Natur der Sache. Umso wichtiger ist es, dass wir auch weiterhin den transparenten und ergebnisoffenen Dialog im gemeinsamen Ringen um die bestmögliche Evidenz suchen.“ Sie haben die Cliffhanger-Frage im ersten Gespräch formuliert. Was ist die Plattform, wo genau das passieren muss, was hier gefordert ist.?
Scherer: Das ist ein absolut wichtiger Punkt. Leitlinienarbeit ist eben kein Wunschkonzert. Das ist ein strukturierter Prozess, da gibt es Phasen, da gibt es Fristen, da gibt es Mitwirkungsmöglichkeiten. Und wenn fundierte Einwände vorliegen, dann müssen die innerhalb des Konsensusverfahrens eingebracht und verhandelt werden. Dafür gibt es all diese Prozesse. Aber nicht im Nachgang und schon gar nicht über öffentliche Rückzüge. Und in der von der DEGAM zitierten Stellungnahme, also in der Replik auf die Replik sozusagen, kommt ein Punkt vor, der in vielen interdisziplinären Leitlinien relevant ist. Natürlich gibt es unterschiedliche Interpretationen von Studien. Das ist ja völlig klar, das muss es auch geben. Und das ist nicht nur erlaubt, das ist erwünscht. Aber sie müssen eben methodisch begründet sein, sie müssen offen diskutiert werden. Schwierig wird es, wenn dann diese Positionen erst in der Kommentierungsphase eingebracht werden oder gar danach und dann mit fundamentaler Kritik öffentlich gemacht werden. Und das aber dann, obwohl man im Konsensprozess eigentlich dabei war und mit am Tisch saß. Und das untergräbt eigentlich das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung für den Endtext. Und so eine Leitlinie ist kein Spaß, das ist ...
Nößler: ... Knochenarbeit.
Scherer: Ja, es ist Knochenarbeit. Denken Sie an die Verantwortung, die wir im Leitlinienerstellungsprozess für die Versorgung haben. Diese Verantwortung, die hat jeder, der dabei ist, mitzutragen. Ja, wir sollten streiten, aber frühzeitig transparent und verbindlich und nicht über irgendeine Rückzugsrhetorik. Sondern über gemeinsame Evidenzarbeit. Ein bisschen so wie wir es hier im Pingpong machen. Und das wäre denn ein gelebter Dialog im Ringen um die bestmögliche Evidenz.
Nößler: Mit der Diabetologie ist das Ganze ja gelungen. Da kennt man auch als Beobachter, also nicht nur als jemand, der an der Leitlinienarbeit beteiligt war, sondern auch als Beobachter kennt man die Versionen der NVL zum Diabetes mellitus, wo einfach nur der Dissens abgebildet wurde in weiten Strecken zwischen diabetologischer Sichtweise und allgemeinmedizinischer. Und da hat es ja die AWMF geschafft – und es wird auch von den Beteiligten immer wieder hervorgehaben, also es wird quasi gefeiert, was das AWMF, das IMWi in dem Moment, und vor allem die damalige Geschäftsstelle von ÄZQ an Moderationsarbeit geleistet haben müssen, damit man es geschafft hat, diese zwei Welten im Gespräch zu halten und sie dazu zu bringen, schrittweise in die Konsensfindung zu kommen. Und das Ergebnis sieht man ja in der letzten Version. Warum gelingt das mit der Kardiologie nicht? Sind die bockig?
Scherer: Das ist jetzt Paartherapie mit nur einem Partner.
Nößler: Aber man muss ja mal anfangen.
Scherer: Sie haben in dem ersten Teil irgendeine Stelle zitiert, wo die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie selber dieses ganze Prozedere, diese Form des Rückzugs als beispiellos ...
Nößler: ... einmaliger Vorgang.
Scherer: ... als einmaligen Vorgang und eigentlich auch als historisch bezeichnet.
Nößler: Aber es hat sich gelesen, als würden sie sich dafür auf die Schulter klopfen.
Scherer: Richtig. Und das Gegenteil sollte der Fall sein. Sie sollten im Grunde genommen sich verschämt in die Ecke begeben und nachdenken, sich sammeln und dann eigentlich von selber darauf kommen. So was sollte es nicht geben, so was darf es eigentlich nicht geben. Dafür ist die Verantwortung für die Versorgung, die wir als Fachgesellschaften tragen, zu groß. Und Sie haben es sehr schön gezeigt, dass es Mittel und Wege gibt, in einem Prozess solche Dinge dann darzulegen und zu lösen. Wir sind ja hier nicht bei einer Dating-App.
Nößler: Könnten wir auch machen. Eine Dating-App und wo sich Kardiologische und Allgemeinmedizinische daten können.
Scherer: Wir müssen auch nicht Best Friends werden und dann am Ende auch alle einer Meinung sein. Aber wir müssen mit dem Dissens vernünftig umgehen. Und Sie haben eben eigentlich das Paradebeispiel dafür gezeigt oder genannt, wie das funktionieren kann.
Nößler: Die Diabetes-NVL.
Scherer: Ja. Oder auch frühere NVLs KHK. Das hat bisher immer geklappt. Und das ist nicht die erste schwierige Leitlinie, mit der wir zu tun haben.
Nößler: Dann wirft es ja trotzdem die Frage auf – ich meine, wir haben jetzt in diesen vielen Minuten, die wir uns mit diesem jetzt beschäftigt haben in zwei Episoden und davor ja eigentlich auch, haben wir eigentlich immer wieder gesagt: Natürlich haben die kardiologischen Autoren Recht mit dem, was sie da schreiben. Und natürlich ist ihre Sichtweise eine korrekte. Aber sie ist halt immer nur ein Teil des Puzzles. Also das ist so – wenn ich es mal mit meinen Worten versuche zu fassen – ein Teil der Quintessens, die Sichtweise der Kardiologen ist eine vollkommen berechtigte. Und die Evidenz, die sie mitbringen, ist genauso berechtigt, was das Problem ist, dass sie jetzt sehr fokussieren. Warum kommt das jetzt so? Warum, Martin Scherer, kommt jetzt dieses Ausweichen der Kardiologen? Dieser einmalige Vorgang? Sie haben es gerade gesagt. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Vor ziemlich genau einem Jahr saßen wir nicht in Köln, sondern wo?
Scherer: In Leipzig.
Nößler: Frühjahrstagung. Und zur Frühjahrstagung des hausärztlichen Hausärzteverband in Leipzig ploppte dann das erste Mal öffentlich die Meldung rein, dass das ÄZQ gekündigt wurde. Und da großes Hin und Her. Mittlerweile wissen wir, es wird eine Zukunft geben für die NVL am ZI, in Kooperation mit der AWMF. Und viele Gespräche, die man damals geführt hat, alles so unter drei Gespräche, die man jetzt nicht öffentlich führen würde, aber ganz oft hat man gehört, diese ÄZQ-Geschichte war immer auch so Ausdruck dieses Gebiets-Clash, dieses Deutungshoheitskampfes, den es zwischen den Fachgebieten naturgemäß gibt. Und ich mache es mal radikal, wir müssen ja irgendwo mit der Paartherapie beginnen, vielleicht auch so ein bisschen der Versuch, nachdem dieser Sturz der NVL, der manchen Fachgebieten nachgesagt wurde – kann man natürlich alles nicht beweisen – jetzt, wo dieser Versuch gescheitert ist und die NVL doch überleben werden am ZI, organisierte jedenfalls am ZI, ist das dann jetzt so das Nachtreten?
Scherer: Ich würde vorsichtig sein mit solchen Zuschreibungen. Ich glaube nicht, dass es da um die Torpedierung der NVL als Ganzes geht. Aber man muss schon sagen, die Art der Kritik wirkt ungewöhnlich frontal. Und das irritiert vor allem dann, wenn man bedenkt, dass die kritisierenden Fachgesellschaften Teil des Leitlinienprozesses waren. Aber es ist so, wie Sie sagen, was wir hier erleben, ist ein Konflikt um Deutungshoheit und Einfluss. Das ist auch okay in gewisser Weise, das gehört auch zur Wissenschaft dazu, aber dann halt bitte innerhalb der Spielregeln, mit Evidenz, mit Kommentierung, mit Kompromissbereitschaft. Dass das ÄZQ hier nicht mehr federführend ist, hat den NVL-Prozess, wie Sie sagen, nicht abgeschafft, sondern neu aufgestellt mit dem Ziel, ihn zu stärken und unabhängig zu machen. Wenn jetzt einzelne Akteure versuchen, über öffentlichkeitswirksame Kritikverfahren oder -inhalte zu delegitimieren, dann müssen wir als Fachgemeinschaft zusammenstehen, nicht gegeneinander. Noch mal, am Ende ist das NVL-Projekt kein Projekt einzelner Personen oder Häuser, es ist ein demokratisch organisiertes Verfahren und es ist ein Akt der Selbstverpflichtung zur besseren Medizin. Das sollte man sich bewahren.
Nößler: Gleichwohl, es bleibt immer der berechtigte Versuch um die jeweilige Deutungshoheit. Das werden Sie nicht abschaffen, Herr Scherer. Das merkt man in der Berufspolitik, in der Wissenschaft. Sie haben von immateriellen Interessen gesprochen, die zu Konflikten führen können.
Scherer: Immateriellen Interessenskonflikte.
Nößler: Gehen wir mal auf eine andere Ebene vielleicht. Jetzt sprechen wir hier in unserem EvidenzUpdate-Podcast, das ist der Versuch quasi wie eine Art, ich würde jetzt sagen Leserbrief an die Kardiologie, nur als Leserbrief zum Hören. Quasi eine Replik auf die Kritik der DGK. Das ist in der Wissenschaft das Natürlichste der Welt, dass jemand was publiziert, ein anderer schreibt einen Leserbrief, dann wird der veröffentlicht und dann hat das ja was von Diskurs. Dann fängt man an und tauscht über diese publizistischen Wege Argumente aus.
Scherer: Nur dass wir das Medium gewechselt haben. Wenn ich das so nehme wie Sie es sagen, hätte ich eigentlich einen Leserbrief schreiben müssen in „Die Kardiologie“.
Nößler: Wir könnten natürlich das jetzt – es wird ja immer alles transkribiert – wir könnten das Transkript als Leserbrief in „Die Kardiologie“ einreichen. Da ist das nächste Heft voll. Und das werden wahrscheinlich die Herausgeber gar nicht annehmen, weil es so lang ist. Aber worauf ich eigentlich hinauswill: Rede, Gegenrede, These, Antithese, Synthese. Ist das Natürlichste der Welt im wissenschaftlichen Diskurs. Ist das jetzt eigentlich super, wenn wir das so machen? Ich meine, wir machen das ja coram publico. Diesen Podcast kann ja jeder hören. Sie haben in der letzten Episode das Thema Partizipative Entscheidung, gemeinsame Entscheidungsfindung ganz oft mit reingebracht. Ist da nicht dieser Podcast, wenn wir hier an die Öffentlichkeit treten, vielleicht sogar ein Beitrag der Aufklärung von potenziell Betroffenen?
Scherer: Das will ich aber schwer hoffen. Also es ist ein inhaltlicher Beitrag, es ist ein Beitrag, der dazu führen soll, dass sich das jemand mit Gewinn anhört, aber es soll natürlich auch der Aufklärung dienen und dem Versuch, wieder in den Diskurs zu kommen.
Nößler: Jetzt haben wir aber hier andere Dimension. Das ist ja nicht eine rein politische Debatte, die wir hier führen. Also aktuelles Beispiel: Sollen wir die AfD verbieten – ja/nein. Da kann man super drüber philosophieren und nachdenken. Wir machen hier eine Debatte, die um Menschenleben sich dreht im Worst Case. Wir alle können davon betroffen sein. Sie sagen, okay, für das Wissenschaftliche, für das Kollegiale eigentlich ein super Beitrag, um ins Gespräch zu kommen, den Beginn einer Paartherapie. Jetzt hören uns aber auch Laien zu. Ist das nützlich, was wir hier tun, aus potenzieller Paitent:innensicht? Oder ist das vielleicht auch eher ein Beitrag zur Verwirrung?
Scherer: Sie meinen, dass sich dann die Öffentlichkeit vielleicht auch wundert, dass die Ärztinnen und Ärzte oder die Wissenschaft miteinander streitet.
Nößler: Genau. Weil es nicht die Wissenschaft gibt.
Scherer: Bei Covid gab es die Wissenschaft angeblich.
Nößler: Auch da nicht. Angeblich.
Scherer: Das stimmt. Also viele Menschen wundern sich, wenn Ärztinnen und Ärzte miteinander streiten. Wir sind hier auf der Frühjahrstagung des Hausärzteverbunds, hier sind genug Leute, die täglich in ihren Praxen erleben, dass die Meinungen gerade mit den spezialisierten Fachgebieten dann mit der hausärztlichen Auffassung vielleicht etwas divergieren. Ich würde aber sagen, das ist kein Zeichen von Chaos, das ist lebendige Wissenschaftskultur. Sie haben eben den Vergleich zur Politik gemacht, Wissenschaft funktioniert nicht wie ein Parteiprogramm, sie lebt vom Zweifel, sie lebt vom Prüfen, sie lebt vom Ringen um Evidenz. Und es ist anders als in er Politik. Anders als in der Politik ist dieses Ringen um Evidenz ein Qualitätsmerkmal. Wenn sich Einschätzungen ändern, weil zum Beispiel neue Daten dazukommen, weil man die Evidenz neu gewichtet, weil man möglicherweise was übersehen hat im ersten Durchlauf. Und ich verstehe das, dass es manchmal von außen so wirkt wie ein Kompetenzgerangel. Das muss für Sie als Fachjournalisten auch ...
Nößler: ... was Großartiges sein.
Scherer: Aber es muss Ihnen manchmal vielleicht wie ein Kompetenzgerangel vorkommen. Aber eigentlich zeigt es doch, wir nehmen Unsicherheiten ernst und wir sind bereit, unsere Empfehlung daran anzupassen, nicht aus Prinzip, sondern weil wir wirklich Verantwortung zur Versorgungsverbesserung oder Verantwortung für eine gute Medizin übernehmen. Was wir aber wirklich verbessern müssen, nach wie vor, das ist die Kommunikationskultur. Also statt Schlagzeilen bräuchte man eher mehr Transparenz im Diskurs, sodass nachvollziehbar bleibt, worum es eigentlich geht. Nicht um Eitelkeit oder Macht oder wer jetzt den Methodensport gewinnt oder um Sieg und Niederlage eines Scores oder welche Lipidstrategie die beste ist, wer am Ende recht hat. Punkt erst mal.
Nößler: Sie haben von lebendiger Wissenschaft gesprochen. Da gibt es übrigens auch ein Buch dazu, das so heißt. Es gibt auch die fröhliche Wissenschaft, die ist schon ein bisschen älter. Und das hat schon fast was Postmodernes, was wir hier machen. Lebendige Wissenschaft. Aber ich höre – bitte korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, aber ich höre so etwas wie ein leichtes Plädoyer bei Ihnen heraus, lebendige Wissenschaft ja, aber bitte in, im besten Fall auch hier und da mal geschlossene Diskursrollen. Nicht coram publico.
Scherer: Ja, unbedingt. Also ich habe viele Jahre Leitlinienarbeit gemacht. Das sind vertraute, vertrauensvolle Runden. Da wird auch intern eine Evidenz ausgetauscht. Da wird über Erfahrungen gesprochen. Und es gibt Gründe für Meinungen und Haltungen. Und Meinung ist etwas, das nicht per se schlecht ist, auch in der Wissenschaft darf es Meinungen geben. Und die muss man offen austauschen können, ohne gleich eine Öffentlichkeit mitliest. Und man muss auch Arbeitsprozesse reflektieren können und vielleicht auch mal gehörig mit dem nötigen Anstand streiten dürfen. Das gehört auch mit dazu. Das muss jetzt nicht jeder mitkriegen. Das ist eine geschlossene Arbeitsatmosphäre. Das dürfte in der Redaktion nicht anders sein oder in einem Institut oder wo auch immer. Da, wo Arbeitsatmosphäre herrscht, da muss auch eine gewisse Form der Privatsphäre oder des geschützten Raumes da sein.
Nößler: Das bringt mich dann – und damit sind wir dieses Mal wirklich sehr viel schneller mit dem Gespräch fertig als mit Teil 1 – fast schon zu einer abschließenden Frage. Eine habe ich dann aber noch. Nämlich Stichwort Paartherapie. Also Sie haben jetzt ein paar Bedingungen formuliert, die alle nicht neu sind, weil man in der Leitlinienarbeit global sich schon seit Ewigkeiten darauf verständigt hat. In Deutschland eben im NVL-Programm zum Beispiel institutionalisiert. Wie machen wir mit dieser Paartherapie jetzt weiter? Wir haben jetzt – haben Sie gesagt – mit der Paartherapie ohne die Partnerin begonnen. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wie schafft man es wieder, aus diesen wissenschaftlich gut begründbaren Statements wieder ins Gespräch zu kommen, um zu sagen: Bringt eure Expertise bitte wieder ein und lasst es uns gut machen.
Scherer: Sie haben eben eine sehr schöne Metaebene-Reflexion gemacht und im Grunde genommen haben Sie gezeigt, wie unterschiedliche lose Kommunikationsenden auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen liegen. Die muss man in irgendeiner Art und Weise wieder zusammenbinden und muss schauen, dass man da wieder in einen Prozess kommt, in einen Austausch kommt. Letztlich müssen wir zurückfinden zu einem Miteinander der Fachgesellschaften.
Nößler: Da verrät Martin Scherer jetzt aber nicht, wie er das macht.
Scherer: Vielleicht nehme ich mal diesen Podcast zum Anlass, zum Hörer zu greifen. Aber das sind vielleicht auch Dinge, wie ich das jetzt alles genau mache, muss ich hier vielleicht gar nicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen. Vielleicht muss ich das auch gar nicht persönlich machen.
Nößler: Es gibt ja noch viele andere.
Scherer: Genau.
Nößler: Also das ist ein weiterer Befund aus diesem Gespräch, dass es das offenbar braucht, dieses Gespräch auch immer wieder neu suchen, wenn es ein Stück weit verschütt gegangen ist, dieses Sprechen können. Offensichtlich ist hier der Befund, dass das Gespräch zuletzt nicht funktioniert hat und man jetzt idealerweise an den Punkt ist, festzustellen, dann müssen wir einen Weg suchen, wie wir das wieder zum Gelingen bringen.
Scherer: Eine Möglichkeit könnte sein, dass dieser Podcast hier rezipiert wird von dem einen oder der anderen Kollegin. Und dann gibt es die Möglichkeit, da auch in den Kontakt zu kommen. Und das gibt ja die Plattform, auf der sich der Podcast befindet, durchaus her, Herr Nößler, wie funktioniert das.
Nößler: In vielen Hinsichten. Man kann ja kommentieren, da ist eine E-Mail verlinkt, an die man sich wenden kann. Also alles möglich.
Scherer: Und dann werden wir es aufgreifen. Und vielleicht machen wir auch mal ein Podcast zu dritt. Es gibt ja dann noch die Talkshow, für die Sie immer wieder eine Lanze gebrochen haben in Teil 1 des Gesprächs.
Nößler: Ja, Talkshow wäre Diskurs. Wobei ich nach wie vor auf den 37 Grad heißen Stuhl auch Interesse hätte. Eine Frage, die mich am Ende aber noch umtreibt – und das wäre fast schon wieder ein Thema für mindestens eine eigene Episode, können wir uns auch mal überlegen, aber ich möchte es trotzdem kurz angesprochen haben, und alle Leitlinien-Autoren dürfen mich dafür gerne grillen, dass ich diese Frage stelle. Aber im konkreten Fall an dieser NVL KHK und der Kritik daran ist uns am Ende eins aufgefallen – das ist all jenen, die Leitlinien nicht selbst machen, vielleicht in der Regel gar nicht klar –, wie langwierig so ein Prozess auch ist. Das macht man nicht mal in einem halben oder in einem Jahr. Das dauert zwei, drei, vier Jahre. Und jetzt ist es tatsächlich aufgefallen, dass die Kardiologen eine kleine Handvoll Arbeiten angeführt haben in ihrer Kritik, die erst Ende letzten Jahres veröffentlicht wurden oder Mitte, die nicht in die Evidenzrecherche einfließen konnten. Und jetzt gibt es ja durchaus Fälle – wir kennen es aus der Pandemie, Sie hatten jetzt selbst gerade die Pandemie angeführt eben – mittlerweile Living Guidelines, die sich als mögliches Instrument etabliert haben. Und wenn man jetzt hier feststellt, so eine Leitlinie hängt im Zweifel auch hier und da immer neuerer Evidenz hinterher. Wäre das nicht auch ein Plädoyer – dieser Kasus, über den wir jetzt so lange gesprochen haben – zu sagen: Lasst uns an unseren Leitlinien und NVL-Prozessen weiterarbeiten, dass wir mehr und mehr Richtung Living Guideline kommen.
Scherer: Unbedingt. Also Living Guidelines sind die Zukunft an der lernenden Medizin. Wir brauchen jetzt unbedingt Leitlinien, die regelmäßig aktualisiert werden, nicht nur in dem Bereich, nicht nur bei KHK, zum Beispiel auch in der Onkologie oder Infektiologie, die Sie eben angesprochen haben.
Nößler: Die Onkopedia ist eine Living Guideline.
Scherer: Wir brauchen Leitlinien, die regelmäßig aktualisiert werden können, ohne dass man jedes Mal das System neu aufrollen muss. Denn warum befürchten Sie denn den Willen zum Grillen bei den Autoren.
Nößler: Weil ich von denen weiß, wie viel Ehrenamt da drinsteckt.
Scherer: Richtig. Also muss man pragmatisch sein und Update-Prozesse entwickeln, die nicht eine neue Auflage der ganzen Ochsentour bedeuten.
Nößler: Also auch die Arbeit für die Autoren leichter machen.
Scherer: Ja, das ist doch alles Ehrenamt. Das schafft dann mehr Aktualität, das schafft mehr Verlässlichkeit, vielleicht sogar bei den Rezipienten oder Anwender:innen auch mehr Vertrauen in die Empfehlung. Und vielleicht – nehmen wir mal hier unseren aktuellen Fall mit den verschiedenen Revaskularisierungsverfahren – reduziert es am Ende auch Konflikte. Denn vieles, was heute kritisch gesehen wird, wäre bei einer Living Guideline vielleicht dann im nächsten Quartal schon wieder auf einer neuen Evidenzbasis. Soviel dazu. Aber auch eine Living Guideline braucht Struktur, braucht Ressourcen, braucht Verbindlichkeit, braucht Spielregeln. Und man muss aufpassen, dass sie nicht zum Flickenteppich werden. Also es gibt den berechtigten Wunsch nach Aktualität, aber es gibt auch den Wunsch nach einer methodischen Struktur.
Nößler: Also Living Guideline heißt Libertinage.
Scherer: Es ist keine Libertinage, nein. Es braucht methodische Standards, es braucht eine Koordination, die zum Beispiel innerhalb des NVL-Systems oder der Grade-Arbeitsgruppen.
Nößler: Martin Scherer, wieder fast 50 Minuten. Wir wollten eigentlich nur noch so ein kleines metaphysisches Gespräch führen.
Scherer: War doch eine kurze Episode im Vergleich zur letzten.
Nößler: Im Vergleich zur letzten ist alles, was wir bislang gemacht haben, kurz. Ich glaube, die längste Folge bis dahin ging eineinhalb Stunden, das haben wir jetzt getoppt mit zwei. Jetzt wissen wir beide, was Sie als Cliffhanger sagen würden, und ich hätte fast die Sorge, dass mindestens eines der Themen, die wir uns vornehmen müssen und wollen, eine 3-Stunden-Episode werden könnte. Wenn Sie mal einen leichten Ausblick geben?
Scherer: Da geht es auch um zwei Leitlinien, die eine etwas weniger kontrovers, die Leitlinie Nackenschmerzen, die ich damals vor vielen Jahren als koordinierender Autor oder als Erstautor ins Leben rufen durfte, da wird es nicht so viel Streit geben. Aber eine, wo ein bisschen mehr Musik drinsteckt im Sinne einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, das ist sicherlich die Leitlinie Prostatakarzinom. Und die ist eigentlich auch wiederum ein Paradebeispiel dafür, dass es dann doch gelingt, irgendwie im Gespräch zu bleiben.
Nößler: Und – das kann man zum Cliffhanger anfügen – Prostatakarzinom, da ist ein richtiger Breakthrough drin. Das wird vieles hier verändern. Weg von diesem Wildwuchs-Screening. Das nehmen wir uns vor. Und bei Nackenschmerzen würde mich natürlich interessieren, aber das können wir jetzt an der Stelle mal offenhalten, ob da auch ein Kapitel drin ist, Prävention von Nackenschmerzen bei Podcast-Aufzeichnungen.
Scherer: Sehr gut.
Nößler: Martin Scherer, vielen Dank für diese Qual, die wir uns hier gegenseitig zugemutet haben. Vielen Dank an alle, die wir beim Zuhören hoffentlich nicht gequält haben und denen es hoffentlich ein Gewinn war.
Scherer: Ich danke Ihnen. Das war eine ziemliche Tour, aber es hat mir Freude gemacht. Und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
Nößler: Bis dann! Tschüss!
Scherer: Tschüss!