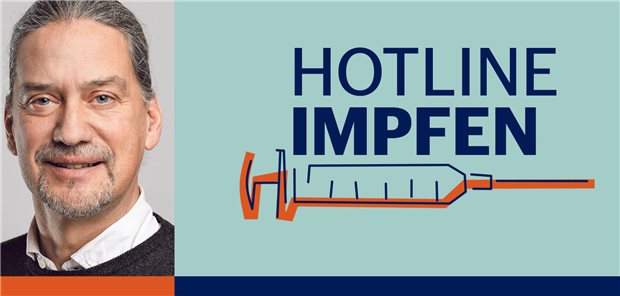BDI zur Digitalisierung
Durch Datenspende Leben retten
Der Bundesverband der Deutschen Industrie bringt mit Beispielen aus der Onkologie in einer Studie den Standpunkt der Unternehmen für eine Digitalisierung im Gesundheitswesen ins Spiel.
Veröffentlicht:
Mit einer aktuellen Studie bringt der BDI seine Empfehlungen für die Digitalisierung des Gesundheitswesens mit ins Spiel.
© vege / stock.adobe.com
Neu-Isenburg. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) beteiligt sich bereits im Vorfeld des demnächst zu erwartenden Entwurfs zum Digitale-Versorgung-Gesetz II mit einer Studie an der Diskussion über den nächsten Schritt der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens.
Das Besondere an der von der „BDI-Initiative Gesundheit digital“ beauftragten Studie „Digital Patient Journey Oncoloy“, die der „Ärzte Zeitung“ vorliegt, ist der patienten- und indikationsbezogene Ansatz. Anhand typischer, aber fiktiver Patienten wird die Patientenlaufbahn entlang der Etappen Prävention, Screening, Diagnostik, Therapie und Nachsorge dargestellt.
Dabei identifizieren die Autoren um Professor Matthias P. Schönermark (SKC Beratungsgesellschaft) bestehende Versorgungsdefizite, die durch den Einsatz digitaler Technologien und Anwendungen behoben werden könnten. Zwei Beispiele:
- Prävention von Hautkrebs: Personen mit hohem Risiko könnten durch eine App besonders animiert werden, regelmäßig zum Hautkrebsscreening zu gehen. Doch bislang fehlen zum Beispiel ausreichende Datengrundlagen für die Berechnung des Risikoprofils. Außerdem, heißt es in der Studie, sei die Vergütung in der Regelversorgung für solche Präventions-Apps nicht gegeben.
- Diagnostik bei Lungenkrebs: Eine algorithmen-gestützte Diagnoseunterstützung erstellt automatisiert Diagnosen und Befunde durch die Auswertung klinischer Daten und hinterlegt die Ergebnisse mit Wahrscheinlichkeiten. Weitere Schritte für die Absicherung der Diagnostik werden empfohlen, bis hin zur Therapieempfehlung bei gesicherter Diagnose. Für eine solche Anwendung fehlen derzeit laut Studie die Daten in ausreichender Qualität. Als Gründe dafür werden unzureichende Dokumentationsstandards, kein sektorübergreifender Zugriff auf die Patientendaten, unterschiedliche Datenschutzregeln in den Ländern, fehlende Schnittstellen und mangelnde Akzeptanz bei den behandelnden Ärzten genannt. Beklagt wird auch eine Unterfinanzierung aufwendiger Diagnostik.
Fünf Handlungsempfehlungen für Gesundheitspolitiker
Aus allen Beispielen auf dem Weg des Patienten durch die Stationen im Gesundheitswesen leitet die Studie fünf Handlungsempfehlungen ab:
- Harmonisierung und Festlegen von zukunftsorientierten Datenschutzregelungen,
- Festlegung von einheitlichen Kommunikations- und Datenstandards zur intersektoralen Interoperabilität,
- Schaffen adäquater Erstattungsoptionen für digitale Lösungsansätze,
- Zugang der industriellen Gesundheitswirtschaft zu pseudonymisierten, aber patientenbezogenen Gesundheitsdaten und
- eine Stärkung des Bewusstseins für die Vorteile von digitalen Anwendungen.
Eine der Hauptforderungen, die der BDI für das DVG II ableitet, ist eine Regelung der Datenspende, also der Spende von Daten aus der Patientenakte in pseudonymisierter Form für die Nutzung in der Forschung.
GKV-Abrechnungsdaten zu Forschungszwecken
„Ähnlich der Blut- oder Organspende ließen sich durch eine Datenspende Menschenleben retten“, kommentiert Iris Plöger, Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung. Auch Abrechnungsdaten der GKV sollten zu Forschungszwecken der Industrie zur Verfügung gestellt werden.
Deutschland sei mit 4300 Euro Spitzenreiter in der EU bei den Pro-Kopf-Ausgaben für die Gesundheitsversorgung, belege aber gleichzeitig in der digitalen Entwicklung im Gesundheitsbereich von 17 untersuchten Ländern den vorletzten Platz, argumentiert Plöger weiter.
Trotz hoher Ausgaben sei „die durch öffentliche Gesundheitsmaßnahmen und Prävention vermeidbare Sterblichkeit in Deutschland seit 2011 lediglich stabil, während sie in vielen anderen EU-Ländern gesunken ist“.
Mit der Studie will der BDI zeigen, wie Deutschland mithilfe der Digitalisierung zu besseren Ergebnissen kommen kann. (ger)