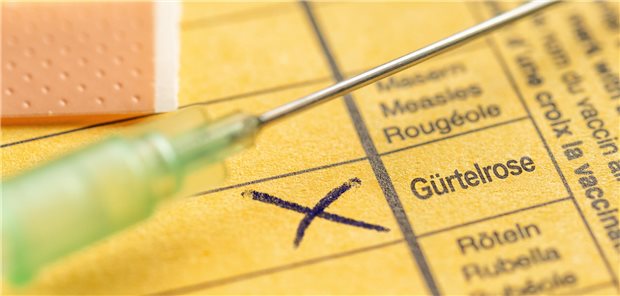Wahrung der ärztlichen Schweigepflicht
E-Evidence-Verordnung: Ausnahmen für Ärzte (noch) nicht absehbar
Die von der EU-Kommission initiierte E-Evidence-Verordnung befindet sich noch in den Trilog-Verhandlungen. Ärztliche und juristische Lobbyisten in Brüssel bohren weiter dicke Bretter, um Gefahren für Patientendaten in Arztpraxen abzuwenden.
Veröffentlicht:
Patientendaten in der Praxis-EDV oder auch in der Cloud sollten nicht besonders geschützt sein, wenn im Rahmen der künftigen E-Evidence-Verordnung Ermittlungsbehörden aus anderen EU-Staaten Zugriff auf deutsche Praxisdaten begehren, so die Argumentation einiger EU-Akteure.
© Klaus Ohlenschläger/picture alliance
Berlin/Brüssel. Schwarze Schafe gibt es nach Ansicht der Europäischen Kommission und des Europäischen Rats in allen Berufsständen – also auch bei Ärzten, Zahnärzten, Anwälten, Journalisten oder Priestern. Diese Berufsgruppen gelten bis dato zumindest in Deutschland als Geheimnisträger. So sind zum Beispiel in Arztpraxen gespeicherte Patientendaten in der Regel sicher vor einem Zugriff der Justiz – der deutschen wie auch der aus anderen EU-Mitgliedstaaten.
Das könnte sich bald ändern, könnten Patientendaten in Praxen nicht mehr vor dem Zugriff durch Ermittlungsbehörden aus anderen EU-Mitgliedstaaten sicher sein – vor allem, wenn sie in der Cloud gespeichert sind. Als Mittel zum Zweck soll die „Verordnung über europäische Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen“ – E-Evidence-Verordnung genannt – dienen.
Gesundheitsdaten: Umgang eruiert
In der jüngsten Vergangenheit haben KBV, BÄK oder auch der Hartmannbund nicht zuletzt mit Blick auf das Berufsgeheimnis immer wieder Nachbesserungen an der E-Evidence-Verordnung angemahnt. Wie die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) auf Nachfrage der „Ärzte Zeitung“ erläuterte, seien im Gegensatz zu Kommission und Rat die EU-Parlamentarier mehrheitlich der Meinung, Ärzte und Vertreter der anderen eingangs erwähnten Berufsgruppen müssten als Berufsgeheimnisträger geschützt werden.
„Vor diesem Hintergrund laufen auf nationaler und europäischer Ebene verschiedene Bestrebungen, die im Rat versammelten Regierungen der EU-Mitgliedstaaten für diese Problematik zu sensibilisieren“, gibt die BZÄK einen kleinen Einblick in den Maschinenraum der (zahn-)ärztlichen Lobby in Brüssel. Auf Initiative der BZÄK habe auch der Council of European Dentists den EU-Gesetzgeber aufgefordert, das Arzt- und Berufsgeheimnisses zu wahren und entsprechende Ausnahmen in der geplanten Verordnung zu verankern.
Nach Informationen des Deutschen Anwaltvereins (DAV) ist ein Gesamtkompromiss nicht absehbar, gibt es aktuell keinen Zeitplan für den weiteren Verlauf der Verhandlungen. Entgegen der von Seiten der BZÄK geäußerten Einschätzung sieht der DAV die Lage nicht so rosig. Die Idee einer kompletten Ausnahme von Berufsgeheimnisträgern wie Ärzten, Journalisten oder Rechtsanwälten finde auch im Parlament keine Unterstützung, da auch diese Berufsträger straffällig werden könnten, sei zu hören. Konkret sei das Berufsgeheimnis zuletzt nicht diskutiert, allerdings sei es anlässlich der Diskussion zum Wohnsitzkriterium erwähnt worden. Hinsichtlich der Definition der „person whose data is sought“ habe Deutschland den Diskussionspunkt aufgeworfen, was passiere, wenn diese Person ein Arzt oder Patient sei. In diesem Zusammenhang sei der Umgang mit Gesundheitsdaten erörtert worden.
Parlament für Notifizierungspflicht
Hält die Verordnung doch noch ein Trostpflaster für Ärzte bereit? Im Falle von „immunities“ sehe sie nach Informationen des DAV einen Ablehnungsgrund vor. Außerdem bestehe, jedenfalls wenn es nach dem Europaparlament gehe, eine Notifizierungs- und eventuell eine anschließende Löschpflicht bezüglich der Datenerhebung für Inhaltsdaten. Unter der Notifizierung ist dabei die Unterrichtung der nationalstaatlichen Ermittlungsbehörde gemeint, die den Zugriff dann erst genehmigen müsse.
Auch die deutsche Anwaltschaft bleibt beim Schutz des Berufsgeheimnisses über die eigene Profession hinaus in Brüssel am Lobby-Ball. „Wir brauchen die Einführung eines obligatorischen und automatischen Benachrichtigungsverfahrens für den Vollstreckungsstaat mit aufschiebender Wirkung. Dabei muss sichergestellt werden, dass das Berufsgeheimnis ordnungsgemäß berücksichtigt wird“, mahnt DAV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Sylvia Ruge. Und ergänzt: „Im Falle von Verstößen gegen Anordnungen müssen überdies Ablehnungsgründe auf der Grundlage der EU-Grundrechtecharta geltend gemacht werden können“.
Um alle am Trilog über die E-Evidence-Verordnung beteiligten Parteien für die potenzielle Gefährdung des Berufsgeheimnisses nochmals zu sensibilisieren, habe sich der DAV an einer Sammlung von Beispielen beteiligt, die unter Federführung des European Digital Rights (EDRi), einer internationalen Vereinigung von Bürgerrechtsorganisationen, nun veröffentlicht wurde.
„Geben Sie eine klare Definition von Immunitäten und Privilegien, die Regeln umfassen im Zusammenhang mit Medienfreiheit, Freiheit der Informationen, Berufsgeheimnis und ärztliche Schweigepflicht“, lautet eine der Forderungen seitens des EDRi an die Trilogparteien.