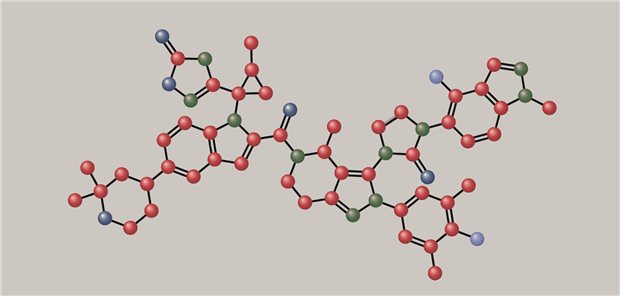Forschungsförderung
Stiftung lässt zwei Millionen Euro für Heidelberger Forscher springen
Die Verknüpfung von Grundlagenforschung mit neuen Ansätzen der Früherkennung soll an der Uniklinik in Heidelberg mit Stiftungsmitteln vorangetrieben werden. Themenfelder: Pankreaskrebs und Demenz.
Veröffentlicht:
Stiftungsmittel in Millionenhöhe stärken die Forschung an der Uni Heidelberg.
© Nicolas Loran / Getty Images / iStock
Heidelberg. Die Manfred Lautenschläger-Stiftung fördert zwei Forschungsprojekte am Universitätsklinikum Heidelberg aus der Neurologie und Onkologie mit jeweils einer Million Euro. „Das Thema Demenz gehört zu den dringlichsten gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen Problemen unserer Zeit. Bis 2050 rechnen wir mit etwa drei Millionen an Demenz erkrankten Menschen in Deutschland. Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine verheerende Erkrankung mit einer äußerst schlechten Prognose. Die Zahl der Todesfälle durch Bauchspeicheldrüsenkrebs stieg in den letzten Jahrzehnten stetig an. In den geförderten Arbeiten verknüpfen die Experten grundlagenwissenschaftliche Forschung mit potenziellen Ansätzen für Früherkennung, Prävention und personalisierte Medizin“, wird Lautenschläger in einer Unimitteilung zitiert.
Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer würdigte die Bedeutung der Förderzusage für den Forschungsstandort Heidelberg: „Heidelberg gehört mit dem Universitätsklinikum, den universitären und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu den bedeutendsten Wissenschaftsstandorten in Deutschland. Von den hier gewonnenen Erkenntnissen im Bereich der Lebenswissenschaften profitieren Menschen weit über die Region hinaus.“
Dies sei auch ein Verdienst großzügiger Forschungsförderung durch Stiftungen und Mäzene. Bauer, die sich in der Hochphase des Landtagswahlkampfes am 14. März befindet, kann die Zuwendung für die Heidelberger Uni nur recht sein. Erst vor Kurzem hat sie in Stuttgart verkündet, einen Kooperationsverbund „Hochschulmedizin Baden-Württemberg“ zu etablieren, unter dessen Dach alle Uniklinika im Ländle stärker kooperieren und zu noch mehr Hochleistung in Forschung und Versorgung angespornt werden sollen.
Gedächtnisstörung als Früherkennungsmarker
Die präklinischen Forschungsarbeiten zu Alzheimer stehen unter Federführung von Professor Hannah Monyer, Ärztliche Direktorin der Abteilung für Klinische Neurobiologie am Uniklinikum. Die Untersuchungen zu Biomarkern für frühe Phasen von Demenz werden von Professor Martin Bendszus, Ärztlicher Direkter der Abteilung Neuroradiologie und Professor Wolfgang Wick, Ärztlicher Direktor der Abteilung Allgemeine Neurologie der Neurologischen Klinik geleitet.
Die Forscher gehen davon aus, dass der Zeitpunkt einer Alzheimer-Früherkennung essenziell ist: In einem möglichst frühen Stadium der Erkrankung könnten Präventionsmaßnahmen bzw. eine potenzielle Behandlung dazu beitragen, ein Fortschreiten der Alzheimer-Demenz zu beeinflussen.
Um diesem Ziel näher zu kommen, untersuchen die Wissenschaftler Anfangsstadien der Alzheimer-Erkrankung im Tiermodell. Sie konzentrieren sich in den Arbeiten auf jene Hirnregionen, die sowohl beim Menschen als auch im Tiermodell frühzeitig betroffen sind und sich als milde Gedächtnisstörungen manifestieren. Im Mausmodell sind Untersuchungen auf Zell-, Netzwerk- und Verhaltensebene simultan möglich.
Diese Studien führen zur Erkennung bestimmter Zelltypen, deren Funktion bereits gestört ist, bevor die ersten Symptome eindeutig erkannt werden können. Die Ergebnisse aus der Grundlagenforschung sind Voraussetzung für die Identifizierung von neuen Biomarkern für frühe Krankheitsstadien. Auch lassen sich bestimmte Nervenzellen bisher nur im Labor gezielt anregen. Die Forscher versprechen sich dadurch Erkenntnisse, inwieweit eine eingeschränkte Zellfunktion und die damit einhergehende Gedächtnisstörung verbessert werden können, heißt es von Uniseite.
Pankreaskarzinom: Besonderheiten von Langzeit-Überlebenden
Professor Markus W. Büchler, Ärztlicher Direktor der Chirurgischen Klinik, und Professor Dirk Jäger, Ärztlicher Direktor der Klinik für Medizinische Onkologie und Geschäftsführender Direktor des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg, haben sich mit ihren Teams für die Forschungsarbeiten zum Pankreaskarzinom zusammengeschlossen. Die Chirurgin Dr. Dr. Susanne Roth leitet die Arbeiten in der Gruppe Pankreaskarzinom.
Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass Entzündungsvorgänge die Tumorentstehung in der Bauchspeicheldrüse wesentlich beeinflussen. Immunzellen in der Mikroumgebung des Tumors fördern meist dessen Wachstum. Patienten, die hingegen eine außergewöhnlich hohe Anzahl an tumorbekämpfenden Immunzellen im Tumorgewebe aufweisen, scheinen besonders lange zu überleben. Bislang ist allerdings noch weitgehend unverstanden wie die Wechselwirkungen zwischen Immunsystem, Tumor und umgebenden Bindegewebszellen funktionieren. Immuntherapeutische Ansätze sind bei dieser Krebserkrankung daher bisher noch wenig erfolgreich.
Die Heidelberger Forscher untersuchen nun Tumor-Zellproben von Patienten mit einem extrem langen Überleben im Vergleich zu Proben von Patienten mit relativ kurzem Überleben nach einer Operation. Ziel ist es nach Uniangaben, besondere Merkmale der Tumoren und der Interaktionen mit der Mikroumgebung zu identifizieren, welche möglicherweise entscheidend zum Überleben beitragen. Diese Erkenntnisse könnten dazu beitragen, neue (immuntherapeutische) Ansatzpunkte für Medikamente zu finden.