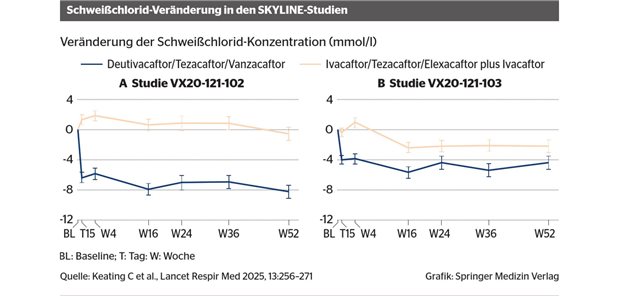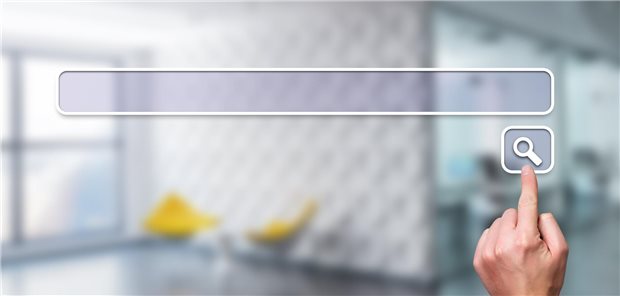Pneumonie
Wann sequenziell impfen?
Patienten mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, an einer Pneumokokken-Pneumonie zu erkranken. Für diese Hochrisikopatienten empfiehlt die STIKO eine sequenzielle Impfung gegen Pneumokokken.
Veröffentlicht:MANNHEIM. Patienten mit einem Immundefekt oder mit immunsuppressiver Behandlung haben im Vergleich zu Personen ohne Grunderkrankungen ein 3,9-fach höheres Risiko für eine Pneumokokken-Pneumonie. Bei chronisch niereninsuffizienten Patienten steigt das Pneumonierisiko sogar um das 5,4-Fache.
Um diese Hochrisikopatienten optimal vor einer lebensbedrohlichen Pneumokokken-Pneumonie zu schützen, empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) am Robert KochInstitut eine sequenzielle Impfung: Zuerst wird mit dem 13-valenten Konjugatimpfstoff mit PCV 13 (Prevenar 13®) geimpft, gefolgt von der Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharidimpfstoff PPSV23 nach sechs bis zwölf Monaten.
Die sequenzielle Impfstrategie sei wichtig, um bei Hochrisikopatienten eine effektive Immunisierung und den bestmöglichen Schutz vor lebensbedrohlichen Pneumokokken-Infektionen zu erzielen, erläuterte Professor Jörg Schelling, niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin in Martinsried.
Breitere Serotypenabdeckung
Durch die Sequenzimpfung werde die möglicherweise bessere Effektivität des Konjugatimpfstoffs um die breitere Serotypenabdeckung des Polysaccharidimpfstoffs ergänzt, so Schelling bei einer von dem Unternehmen Pfizer unterstützten Veranstaltung in Mannheim.
Zu der Hochrisikogruppe zählen laut STIKO Patienten mit T-ZellDefizienz beziehungsweise gestörter T-Zell-Funktion, B-Zell- oder Antikörperdefizienz, Komplement- oder Properdindefizienz, funktionellem Hyposplenismus, Krebs, HIV-Infektionen, immunsuppressiver Therapie, Immundefizienz bei chronischem Nierenversagen, nephrotischem Syndrom oder chronischer Leberinsuffizienz sowie Patienten mit anatomischen oder Fremdkörper-assoziierten Risiken für eine Pneumokokken-Meningitis, wie zum Beispiel Liquorfistel oder Cochlea-Implantat. Auch Patienten im Alter von 2 bis 15 Jahren mit chronischen Herz- und Atemwegserkrankungen oder Diabetes sollten die sequenzielle Impfung erhalten.
Für gesunde über 60-Jährige und Patienten mit anderen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Asthma, COPD, Diabetes oder chronische Herzerkrankungen wird die Impfung mit PPSV23 als ausreichend erachtet.
Daher sollte der Arzt den Impfstatus von Hochrisikopatienten im Auge behalten und die Betroffenen über ihr Risiko und die Impfung aufklären, riet Schelling. Um die Durchimpfungsrate in Deutschland zu verbessern, sei eine engere interdisziplinäre Zusammenarbeit von Krankenhaus-, Fach- und Hausärzten wünschenswert.