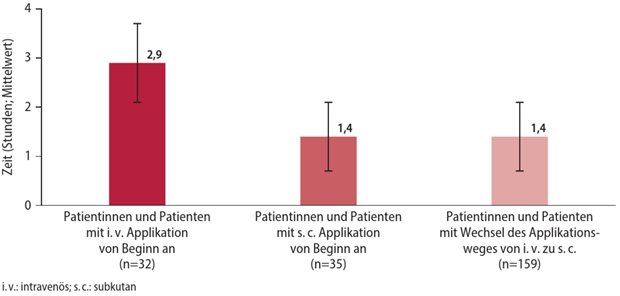Hauptstadtkongress 2021
Einhäupl: „Etwas mehr Pragmatismus und weniger Ideologie ist angeraten“
Die Pandemie ist – natürlich – auch ein Thema beim Hauptstadtkongress 2021, sagt dessen neuer Präsident Professor Karl Max Einhäupl. Ein Gespräch zur Rolle der Ärzte in der Corona-Krise, den Schub für die Digitalisierung und die Frage des Zusammenhalts in Gesellschaft und Medizin.
Veröffentlicht:
© Monika Skolimowska / dpa / pictu
Ärzte Zeitung: Haben Sie schon eine Überschrift für Ihre Eröffnungsrede zum Hauptstadtkongress formuliert, Herr Professor Einhäupl?
Professor Karl Max Einhäupl: Wir werden sicher nicht umhinkommen, das Thema Corona zu adressieren. Die Pandemie hat die Gesellschaft und unser Gesundheitssystem nachhaltig berührt. Mir schwebt eine Bestandsaufnahme vor – aber nicht als Sammelsurium von Dingen, die schlecht gelaufen sind. Es geht darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und Chancen zu erkennen, die Corona bietet.
Hat Deutschland eine gute Figur gemacht in der Corona-Krise?
Es gibt weltweit wohl kein Land, wo alles funktioniert hat. Das zeigt, wie schwierig es ist, in Krisensituationen die Dinge noch adäquat zu regeln und gleichzeitig die Mehrzahl der Menschen mitzunehmen. Das Gros der Bundesbürger ist mitgegangen. Die medizinische Versorgung hat sich zudem als robust erwiesen im Vergleich zu anderen Staaten. Aber es sind auch Probleme zutage getreten.
Welche?
Ich bin doch überrascht, dass es eine relativ große Gruppe von Menschen gibt, die derart uneinsichtig ist und der es so schwerfällt, etwas zu akzeptieren, was sie persönlich vielleicht anders organisiert hätten. Da stellt sich die Frage, wie es uns künftig gelingt, eine Gemeinschaftsidee zu entwickeln und umzusetzen. Gesellschaftliche Kohärenz ist ein Thema, dem wir uns viel stärker widmen müssen, jenseits von Gesundheitsthemen.
Mit der Video-Botschaft von EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen wird die europäische Dimension bei der Pandemie-Bekämpfung beleuchtet. Gilt das nur für die Impfstoffbeschaffung?
Das Virus kennt keine Grenzen. Umso wichtiger ist internationale Kooperation und Koordination. Aber auch für Europa ist deutlich geworden, wie schwierig es ist, für die große Zahl der Menschen auf dem Kontinent konsensfähige Lösungen zu finden. Das beginnt beim Schengen-Raum und endet bei der Impfstoffbeschaffung. Hier muss Europa besser werden, wenn wir die Menschen für Europa begeistern wollen.
Niedergelassene Ärzte haben sich als ersten Schutzwall in der Pandemie bezeichnet. Zu Recht?
Im Großen und Ganzen haben die Ärzte ihre Aufgaben gut gemacht. Sie standen an vorderster Front der Pandemie – genauso wie MFA und Pflegekräfte. Sie mussten „nebenher“ die Regelversorgung aufrechthalten.
Mit Blick auf die Impfkampagne hätte man die Niedergelassenen früher einbinden müssen. Das Tempo beim Impfen ist seit Anfang April – also dem Einstieg der Hausärzte in die Impfkampagne – erheblich gestiegen. Ein Indiz, dass der ambulante ärztliche Sektor eine Stärke unseres Gesundheitssystems ist.
Professor Karl Max Einhäupl
- Präsident des Hauptstadtkongresses seit Dezember 2020
- Vorstandschef der Berliner Charité von 2008 bis 2019
- Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina
Hat denn das Zusammenspiel der Sektoren funktioniert oder haben sich alte Grabenkämpfe in der Pandemie bestätigt?
Unsere Gesellschaft ist von Wettbewerb geprägt. In einem gewissen Umfang ist das auch gut so. Natürlich kommen dann Partikularinteressen zum Vorschein – hier die der Kliniklobby, dort die der Vertragsärzte. Umso wichtiger sind übergeordnete Regularien, um solche Einzelinteressen im Zaum zu halten. Den Begriff der Kohärenz muss man auch auf das Gesundheitssystem herunterbrechen.
Bietet die Pandemie auch eine Chance, die knapp 400 Gesundheitsämter neu aufzustellen?
Es wird sicher eine Welle der Unterstützung des ÖGD geben. Die ist auch nötig. Solange Gesundheitsämter per Fax Daten sammeln und mitteilen, haben wir ein Riesenproblem.
Die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs ist Gegenstand mehrerer Veranstaltungen beim Kongress. Hinkt die Realität den vielen Paragrafen, die zuletzt auf den Weg gebracht wurden, hinterher?
Das ist ein generelles Problem in Deutschland – und ein besonderes im Gesundheitsbereich. Schaut man etwa nach Skandinavien oder ins Baltikum, dann schneiden wir schlecht ab.
Die Pandemie hat einen positiven, wenn auch ungewollten Effekt gehabt. Das, was wir jetzt an digitaler Affinität entwickeln mussten, bleibt. Ein Beispiel sind Video-Sprechstunden in Praxen. Es braucht aber auch die Ausstattung – bei Ärzten wie Patienten. Da bleibt noch viel zu tun.
Datenschutz ist wichtig – bei Gesundheitsdaten gilt das besonders. Wird dieses Argument mitunter überstrapaziert?
Ich bin froh, dass wir in Deutschland eine lebhafte Diskussion haben – sowohl derer, die für ein Maximum an Datenschutz werben als auch derer, die das Volumina an Datenschutz kritisieren. Generell lässt sich sagen: Für Gesunde mag Datenschutz an erster Stelle stehen. Wenn man krank wird, ist man froh, wenn Ärzte und Kliniken Daten rasch und unkompliziert austauschen können. Etwas mehr Pragmatismus und weniger Ideologie ist angeraten.
Datengestützte und KI-basierte Programme zu Diagnostik und Therapie schießen wie Pilze aus dem Boden. Droht künstliche Intelligenz bald medizinische menschliche Expertise zu ersetzen?
KI macht mir keine Angst. Sie fordert mich als Arzt heraus. KI ist in der Lage, Probleme zu lösen. Wir verstehen aber noch nicht bis ins letzte Detail, wie es KI schafft, dieses oder jenes Problem zu lösen. Wir werden das 21. Jahrhundert nicht beenden, ohne KI in unser tägliches Leben eingebaut zu haben – so wie das bei Internet und WLAN heute schon der Fall ist.
Der Hauptstadtkongress bringt auch junge Ärzte und Pflegekräfte zusammen. Denkt die neue Generation anders über Streitthemen wie Delegation und Substitution?
Interdisziplinarität ist ein großes Thema. Die Gewinner bei diesem Thema werden sich von den Verlierern darin unterscheiden, dass sie bereit sind, Interdisziplinarität tatsächlich zu leben und nicht zu bekämpfen. Wir brauchen mehr Differenzierungen und neue Berufe. Es muss möglich sein, Pflegekräfte so weiter zu qualifizieren, dass sie in bestimmten anspruchsvollen Tätigkeiten besser ausgebildet sind als Ärzte.
Und der Effekt?
Pflege bekommt eine Perspektive. Der Personalmangel, den wir dort beklagen, hängt auch mit fehlenden Karrieremöglichkeiten zusammen. Die müssen wir schaffen. Ärzte sollten den Prozess nicht mit Scheuklappen begleiten. Es geht um Augenhöhe. An der sollten alle Gesundheitsprofessionen ein Interesse haben.