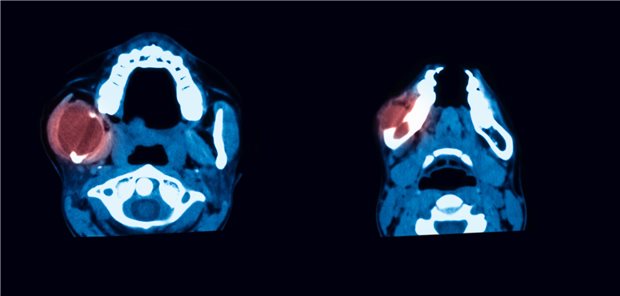Antidepressive Therapie rettet Leben nach Herzinfarkt
BERLIN (mut). Bei Herzinfarktpatienten lohnt es sich besonders, nach Depressionen zu schauen: Denn werden Infarktpatienten adäquat antidepressiv behandelt, lässt sich offenbar das Risiko für Re-Infarkte um bis zu zwei Drittel senken.
Veröffentlicht:
Gerade bei Herzinfarktpatienten ist es wichtig, nach Depressionen zu schauen, denn diese können das Leben drastisch verkürzen.
© Niderlaner/fotolia.com
Auf den Herzinfarkt folgt nicht selten eine Depression: Etwa jeder fünfte Infarktpatient erkrankt in den ersten Wochen nach dem Ereignis, und diese Patienten haben bekanntlich ein deutlich höheres Risiko, in den folgenden Monaten zu sterben, als Infarktpatienten ohne Depression.
Auch in Langzeitstudien war die Sterberate bei depressiven Herzinfarktpatienten deutlich erhöht - teilweise doppelt so hoch wie bei nicht depressiven Leidensgenossen (wir berichteten). Erklärt wird dies mit der schlechten Compliance von Depressiven bei der lebenswichtigen kardiovaskulären Medikation, aber auch mit erhöhten Werten von Entzündungsparametern. Unklar war jedoch bislang, ob eine antidepressive Therapie am erhöhten Sterberisiko tatsächlich etwas ändern kann. Genau darauf deuten nun die Daten einer aktuellen Studie mit knapp 240 Patienten nach NSTEMI-Infarkt.
Von diesen Patienten waren 80 nicht depressiv und dienten als Kontrollgruppe, die übrigen 160 Patienten - alle mit schweren Depressionen - erhielten entweder eine intensive antidepressive Betreuung mit Psychotherapie und/oder Arzneien. Zudem wurden sie von Psychologen, Sozialarbeitern und Psychiatern regelmäßig betreut. Die anderen 80 depressiven Patienten sowie deren Ärzte wurden nur darüber informiert, dass depressive Symptome vorliegen.
Die Ergebnisse nach drei Monaten: Mit intensiver Betreuung gingen die Depressionen wie erwartet deutlich stärker zurück als ohne (minus 5,7 versus minus 1,9 Punkte auf der Skala BDI). Dies korrelierte mit der Zahl der Re-Infarkte: So mussten nur drei der Patienten (4 Prozent) mit intensiver antidepressiver Betreuung erneut wegen Herzinfarkten in eine Klinik, ohne Betreuung waren es jedoch zehn (13 Prozent) - also mehr als das Dreifache. Zum Vergleich: Bei den nicht Depressiven waren es fünf (6 Prozent). Trotz der geringen Zahlen - ein Manko der Studie - waren die Unterschiede signifikant (Arch Intern Med 2010, 170:600).