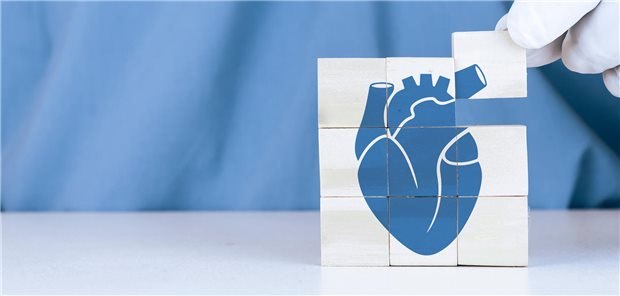Abklärung von Ursachen
Eisenmangelanämie: Höhere Ferritin-Untergrenze für mehr Sicherheit?
Bei neu aufgetretener Eisenmangelanämie gilt es, die Balance zu finden zwischen Wachsamkeit gegenüber möglichen malignen Ursachen und den begrenzten Ressourcen und potenziellen Nebenwirkungen gastrointestinaler Endoskopien. Überlegungen und Empfehlungen dazu aus den USA.
Veröffentlicht:
Die amerikanische Gastroenterologengesellschaft AGA empfiehlt in ihren Leitlinien von einem Eisenmangel als Ursache einer Anämie bereits ab Werten ≤ 45 µg/l auszugehen und sofern Anamnese und klinische Untersuchungen keine eindeutigen Erklärungen für die Eisenmangelanämie (IDA) bieten, spricht die AGA für Männer und postmenopausale Frauen eine starke Empfehlung zu Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) plus Koloskopie aus.
© JEGAS RA - stock.adobe.com
Pittsburgh. Die amerikanische Gastroenterologengesellschaft AGA empfiehlt in ihren Leitlinien seit einigen Jahren, von einem Eisenmangel als Ursache einer Anämie nicht (wie von der WHO empfohlen) erst ab einem Serum-Ferritin ≤ 15 µg/l, sondern bereits ab Werten ≤ 45 µg/l auszugehen (Gastroenterology 2020; online 15. August).
Sofern Anamnese und klinische Untersuchungen keine eindeutigen Erklärungen für die Eisenmangelanämie (IDA) bieten (z. B. vegane Ernährung, Blutverlust außerhalb des GI-Trakts), spricht die AGA für Männer und postmenopausale Frauen eine starke Empfehlung zu Ösophagogastroduodenoskopie (ÖGD) plus Koloskopie aus. Für prämenopausale Frauen wird die bidirektionale Endoskopie lediglich vorgeschlagen, alternativ kann bei ihnen auch zuerst eine Eisensubstitution versucht werden.
Die Erhöhung der Ferritin-Untergrenze erlaubt der Fachgesellschaft zufolge, die Zahl der übersehenen gravierenden IDA-Ursachen, vor allem von GI-Tumoren, zu senken, ohne die Zahl der falsch positiven Diagnosen übermäßig zu erhöhen.
Skepsis am Vorgehen
Zweifel an dieser Vorgehensweise werden in einem Research Letter laut, den Omar Al Ta‘ani vom Allegheny Health Network in Pittsburgh mit Kollegen und Kolleginnen verfasst hat (JAMA Intern Med 2025; online 25. August). Das Ärzteteam hat näherungsweise berechnet, was die Umsetzung dieser Empfehlungen tatsächlich bedeuten würde: Anhand von Daten aus der Querschnittsstudie NHANES kommen sie zu dem Schluss, dass durch die Erhöhung der Ferritin-Untergrenze in den USA die Zahl der (nicht schwangeren) Erwachsenen mit IDA von 5,9 auf 9,2 Millionen steigen würde.
Von den 3,3 Millionen zusätzlichen IDA-Patienten wären 1,5 Millionen Männer und postmenopausale Frauen mit einer starken Empfehlung zur Endoskopie und 1,8 Millionen prämenopausale Frauen mit einer bedingten Empfehlung.
Da es zum Erfassen von Menorrhagie, der Hauptursache von IDA bei Frauen vor der Menopause, keine validierten Instrumente gibt, sieht die Ärztegruppe die Gefahr, dass auch viele der jungen Frauen trotz der erwartbar niedrigen Ausbeute mittels ÖGD und Koloskopie untersucht würden.
Mehr Endoskopien
Zwar räumen Al Ta‘ani et al. ein, dass die Zahl der Endoskopien, die bei leitliniengemäßem Vorgehen zusätzlich anfallen würden, durch ihre Berechnung wahrscheinlich überschätzt wird, weil z. B. die AGA-Empfehlungen für Menschen mit IDA und GI-Symptomen (z. B. Hämatochezie) keine Geltung haben, diese Symptome in NHANES aber nicht erfasst werden. Dennoch würden ihre Ergebnisse deutlich machen, dass „zusätzliche Forschung nötig ist, um Leitlinien für das IDA-Management zu entwickeln, die nach der wahrscheinlichsten Ursache der IDA stratifiziert sind“.
Auch die Verfasser eines begleitenden Editorials halten die AGA-Empfehlungen für zweischneidig (JAMA Intern Med 2025; online 25. August): „Weil die bidirektionale Endoskopie zu selten erfolgt, könnte die Grenzwerterhöhung die Detektion [von GI-Karzinomen] in Hochrisikogruppen verbessern. Bei prämenopausalen Frauen besteht jedoch die Gefahr, dass selbst eine bedingte Empfehlung Endoskopien mit geringem Ertrag antreibt.“
Die Kommentatoren von der University of Michigan um Andrew Read schlagen deswegen ein geschlechts- und altersspezifisches Vorgehen vor:
- Ältere Menschen mit asymptomatischer neu aufgetretener Anämie: Die Prä-Test-Wahrscheinlichkeit einer IDA liegt bei rund 15 Prozent. Ein Serum-Ferritin < 45 µg/l besitzt daher ausreichende diagnostische Power: Ein positiver Befund erhöht die Post-Test-Wahrscheinlichkeit auf 66 Prozent, ein negativer reduziert sie auf 3 Prozent. Zwar kann ein normaler Ferritin-Wert, weil es sich um ein Akute-Phase-Protein handelt, eine IDA nicht ausschließen, daher sollte in diesem Fall z. B. auch die Transferrin-Sättigung betrachtet werden. „Trotzdem hat Ferritin zur Anämieabklärung in dieser Population eindeutig einen klinischen Nutzen, besonders angesichts der engen Beziehung zwischen steigendem Alter und GI-Krebs“, so Read et al. Ein positiver (niedriger) Ferritin-Wert solle deswegen ÖGD und Koloskopie nach sich ziehen und ein negativer (normaler) Wert die Abklärung anderer Anämieursachen zur Folge haben.
- Jüngere Männer mit Anämie: Die Prä-Test-Wahrscheinlichkeit eines Eisenmangels ist laut Read ähnlich wie bei älteren Menschen. „Sofern es keine anderen Symptome oder Testergebnisse (z. B. erhöhte Gewebs-Transglutaminase) gibt, sollte ein positives (niedriges) Ferritin eine bidirektionale Endoskopie veranlassen, wohingegen ein negativer Test eine GI-Ursache unwahrscheinlich macht.“
- Prämenopausale Frauen mit Anämie: Wegen der hohen Prä-Test-Wahrscheinlichkeit für eine IDA von rund 80 Prozent ist das Serum-Ferritin wenig informativ, wie Read et al. betonen. Ein Wert < 45 µg/l erhöhe die Post-Test-Wahrscheinlichkeit zwar auf 98 Prozent, ein negativer senke sie aber nur auf 39 Prozent, einen Wert, der zu hoch ist für den Ausschluss einer IDA. In dieser Gruppe könnten andere Eisenmarker von Nutzen sein, wichtiger aber noch sei die klinische Einschätzung: Es müsse geklärt werden, ob eine Menorrhagie ursächlich sein könnte und ob GI-Symptome und Red Flags bestünden.
In der deutschen S1-Leitlinie zur Eisenmangelanämie sind die Empfehlungen zur Ursachensuche recht allgemein gehalten: „Bei fehlendem Beweis einer alimentären Ursache muss mit geeigneten Methoden nach Resorptionsstörungen (z. B. glutensensitiver Enteropathie, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und anderen Malabsorptionssyndrome, auch Helicobacter-pylori-Besiedelung des Magens), die Kompensationsfähigkeit übersteigenden Verlusten (offenen und okkulten chronischen Blutverlusten), chronischen entzündlichen Erkrankungen (mit einer Eisenverschiebung in das RHS) oder seltenen genetischen Ursachen gesucht werden.“