Hörtraining hilft bei Tinnitus wenig
Bei Tinnitus hat ein Verfahren, bei dem das Gehör gezielt auf bestimmte Frequenzen im Bereich des Hörverlusts trainiert wird, offenbar nur wenig Wirkung.
Veröffentlicht: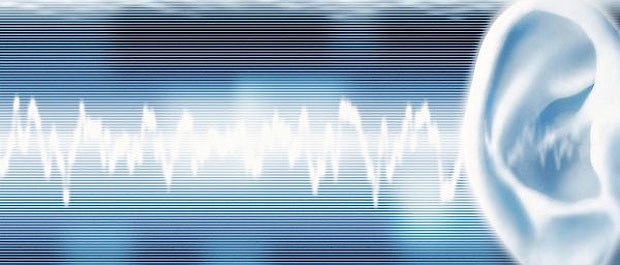
Das Frequenzdiskriminierungstraining soll verlorengegangene Töne wieder hörbar machen.
© Gary Cornhouse/fotolia.com
NOTTINGHAM. Der Brite Derek J. Hoare und seine Kollegen von der Universität Nottingham testeten den Effekt eines Frequenzdiskriminierungs-Trainings auf die Tinnitus-Symptomatik.
An der Studie beteiligten sich 70 Patienten, die seit mehr als sechs Monaten an Tinnitus litten. Der Hörabfall musste 40 dB oder mehr bei mindestens einer Testfrequenz zwischen 0,125 und 14 kHz betragen (JARO 2012; online am 4. April).
Insgesamt konnten die Forscher nur eine relativ geringfügige Verbesserung im Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ) um 7 Prozent herbeiführen. Der THQ enthält 27 Fragen zu gesundheitlichen, emotionalen und sozialen Tinnitusfolgen (maximale Gesamtpunktzahl: 1500) sowie zu Hörproblemen (maximale Punktzahl: 800).
Überraschend war die Tatsache, dass die Therapie nicht etwa besser wirkte, wenn man das Gehör gezielt auf Frequenzen im Bereich des Hörverlusts trainierte.
Falsch verschaltete Neuronen
Die Diskriminierungsschwelle lag bei Teilnehmern, die mit Komplextönen stimuliert worden waren, sogar höher.
Hoare hatte zuvor postuliert, dass die Frequenzverstärkung im Bereich des Hörverlusts besonders geeignet sei, neuronale Fehlschaltungen in der Hörrinde, die den Tinnitus bewirken, zu korrigieren. Das wird durch die Studie widerlegt.
Dem Frequenzdiskriminierungstraining liegt folgende Hypothese zugrunde: Bildgebende Verfahren konnten zeigen, dass bei Tinnituspatienten die neuronale Aktivität in der Hörrinde des Gehirns verändert ist.
Man nimmt an, dass bei einem Hörverlust zentrale akustische Nervenbahnen ihres "Inputs" aus dem Innenohr beraubt werden. Das Gehirn versucht, diesen Wegfall zu kompensieren und reguliert die Aktivität in der zentralen Hörbahn hoch.
Die Folge ist eine Umorganisation der Hörrinde mit fehlerhaften Verschaltungen von Neuronen. Diese werden nun nicht mehr durch die Frequenzen erregt, für die sie ursprünglich bestimmt waren. Das Hörtraining soll helfen, diese fehlerhaften Umbauvorgänge rückgängig zu machen.
Hoare und sein Team hatten ihre Patienten in drei Gruppen eingeteilt: Die einen trainierten mit Reintönen im Bereich des normalen Hörvermögens, die zweite Gruppe mit Reintönen im Bereich des Hörverlusts und die dritte mit harmonischen Tonzusammensetzungen mit gefilterten Frequenzen, die ebenfalls im Bereich des Hörverlusts lagen.
Nutzen allenfalls bei leichtem Tinnitus
Die Ergebnisse unterschieden sich in allen drei Gruppen kaum. Die subjektiv empfundenen Einschränkungen durch den Tinnitus wurden im Schnitt um 76 Punkte im THQ reduziert, die Besserung hielt noch nach einem Monat an.
Allerdings schienen hauptsächlich Patienten mit leichteren Beschwerden zu profitieren. Von den 62 Teilnehmern, die bei Trainingsbeginn durch die Ohrgeräusche in ihren Alltagsaktivitäten eingeschränkt waren (THQ-Werte > 600) gelangten nur sieben unter diese kritische Grenze.
Auch die Hoffnung der Autoren, dass ein intensiveres Training den Effekt verstärken könne, blieb unerfüllt. Im Ergebnis machte es keinen Unterschied, ob die Patienten über zwei Wochen fünf jeweils einstündige Sitzungen wöchentlich absolvierten oder einen Monat lang ebenfalls fünfmal wöchentlich nur eine Viertelstunde trainierten.
Quelle: www.springermedizin.de












