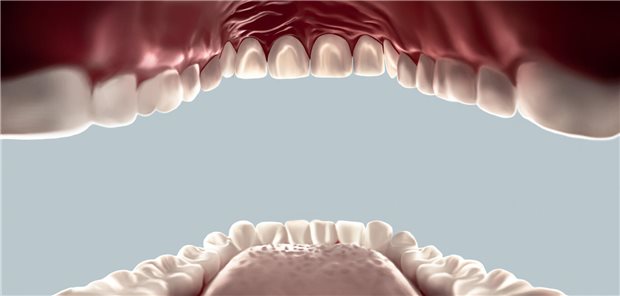Prävention und Früherkennung
Kardiale Gefährdung bei Glukosetoleranz-Störung
Bereits eine gestörte Glukosetoleranz, die Diabetes-Vorstufe, fördert Herzinfarkt und Schlaganfall. Und: Gestörte Glukosetoleranz wird immer noch zu spät diagnostiziert.
Veröffentlicht:Ein Verdacht auf gestörte Glukosetoleranz besteht immer bei Menschen mit metabolischem Syndrom. Bei abdomineller Adipositas wird ein Screening empfohlen mit:
- Blutdruckmessung,
- Nüchtern-Blutentnahme mit Bestimmung von Blutzucker, Gesamtcholesterin, HDL- und LDL-Cholesterin, Triglyzeriden und Harnsäure
- Bestimmung des Body-Mass-Indexes (BMI), errechnet aus Körpergröße und Körpergewicht und
- Messung des Taillenumfangs in der Mitte zwischen Rippenbogen und Hüftknochen und zwar am stehenden, entkleideten und normal atmenden Patienten. Beim Bauchumfang gilt: Mehr als 94 cm sollten es bei Männern nicht sein, bei Frauen nicht mehr als 80 Zentimeter.
Der Taillen- oder Bauchumfang hat eine wesentlich größere Bedeutung für das kardiovaskuläre Risiko als der BMI, denn er ist ein Maß für das abdominelle Fettgewebe. Dieses ist wegen seiner Hormonproduktion ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung eines Typ-2-Diabetes. Je mehr abdominelles Fett ein Patient hat, um so größer ist sein kardiovaskuläres Risiko.
Sind außer einem erhöhten Bauchumfang zwei Parameter auffällig, etwa der Blutdruckwert und das LDL-Cholesterin, spricht man vom metabolischen Syndrom. Wenn bereits die Diagnose Typ-2-Diabetes steht und der Patient einen erhöhten Bauchumfang hat, ist von einem metabolischen Syndrom auszugehen.
Bei Patienten mit familiärer Belastung für Typ-2-Diabetes (Verwandte 1. Grades von Typ-2-Diabetikern) und einem auffälligen Blutglukose-Wert sollte ein oGTT gemacht werden. Dieser ist auch bei Frauen mit Gestationsdiabetes in der Anamnese oder einem polyzystischen Ovarialsyndrom indiziert. (Rö)