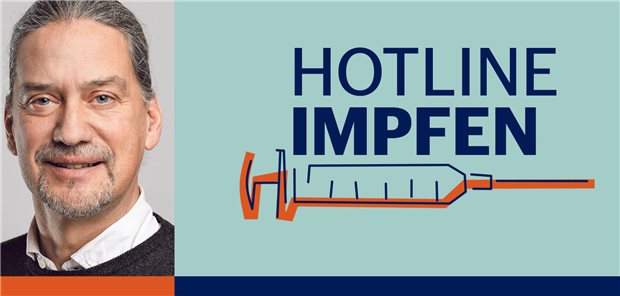Onkologen für Ausbau klinischer Krebsregister
BERLIN (af). Klinische Krebsregister sammeln Daten von Patienten. Diese Daten können dazu genutzt werden, um beispielsweise die Versorgung von Tumorpatienten zu verbessern. Doch die systematische Datenerhebung in den Tumorzentren steht noch am Anfang. Das war das Fazit des Symposiums "Daten für Taten" der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren (ADT) am Mittwoch in Berlin.
Veröffentlicht:"Tumorzentren ohne Krebsregister sind in Zukunft undenkbar", sagte der Staatssekretär im Gesundheitsministerium Brandenburg, Winfrid Alber. Wann genau die Zukunft beginnt, konnte er nicht sagen. Derzeit sind klinische Krebsregister gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Kooperationsverbund für flächendeckenden Ausbau
Die in klinischen Registern gesammelten Daten sollen Ärzten in Kliniken und Praxen, aber auch den an Krebs erkrankten Patienten, Hinweise geben, etwa wenn es um die Wahl von Behandlungsmethoden geht.
Wie das im Alltag funktionieren soll, ist derzeit noch unklar. Immerhin: Die im Kooperationsverbund "Qualitätssicherung durch klinische Krebsregister" zusammengeschlossenen Onkologen, Ärzte und Politiker haben eine Resolution formuliert, die sich an die Bundesregierung, den Gemeinsamen Bundesausschuß, die Bundesländer, die Krankenkassen und an die betroffenen Verbände wendet.
Darin werden die Verantwortlichen aufgefordert, den "flächendeckenden Ausbau klinischer Krebsregister politisch zu unterstützen und den im Koalitionsvertrag bekundeten Willen, die Volkskrankheit Krebs zurückzudrängen, umzusetzen." Dazu sollen die vorhandenen Erfassungssysteme optimiert und vernetzt werden.
Die Probleme reichen einige Jahre zurück. Bei der Evaluation der Tumorzentren 2001 habe sich herausgestellt, daß nur wenige Zentren den Anforderungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren gerecht geworden seien, sagte Gerd Nettekoven. Er leitet für die Krebshilfe ein Evaluationsprojekt. Seine Hauptforderung lautet: Tumorzentren sollen Patienten wohnortnah auf dem Stand der Wissenschaft behandeln.
Dazu müßten die klinischen Register die Daten der Krankenhäuser und die Daten der niedergelassenen Ärzte einer bestimmten Region zusammenführen, Aussagen über die Qualität der erbrachten Leistungen ableiten und Ärzten und Patienten eine Rangliste mit den besten Behandlungsmöglichkeiten anbieten.
Dieses Ziel sei noch nicht in Sicht, sagte Winfrid Alber: "Ohne klinische Krebsregister sei interdisziplinäre onkologische Versorgungsforschung wie ein Tanker im Nebel ohne Radar", zitierte er einen früheren Präsidenten der Deutschen Krebsgesellschaft. Ohne dieses Radargerät fehlten Ärzten, Krankenkassen und Politik die Erkenntnisse, die für rationale Entscheidungen bei der onkologischen Versorgung nötig seien.
Versorgungsforschung mit Daten aus den DMP?
Wulf-Dietrich Leber vom AOK-Bundesverband zog die Möglichkeit in Betracht, bereits bestehende Datenregister zu nutzen. Daten aus Disease-Management-Programmen (DMP) und dem Pauschalsystem in den Kliniken (DRG), die Abrechnungsdaten der Niedergelassenen sowie die Versichertendaten bildeten einen Schatz, der noch nicht gehoben sei. Die Datensicherheit müsse jedoch immer gewährleistet sein.
"Daten für Taten" hatte die ADT ihr Symposium zum Stand der Klinischen Krebsregister genannt. Winfrid Alber traf es besser. Er sagte: "Es tut sich was, aber leider nicht genug".
STICHWORT
Tumordokumentation
Die Tumordokumentation ist ein wichtiges Instrument bei der Qualitätssicherung. Die Dokumentation erfolgt in epidemiologischen und klinischen Krebsregistern. In epidemiologischen Registern - sie sind gesetzlich vorgeschrieben - werden die Daten in einer bestimmten Region erfaßt. Klinische Krebsregister sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Sie sammeln Daten von einzelnen Behandlungszentren. Die Daten ermöglichen in erster Linie Aussagen über die Qualität von Krebstherapien.