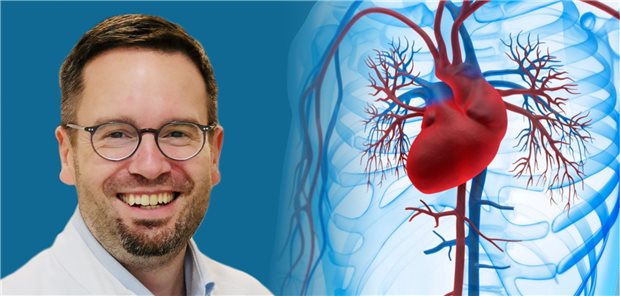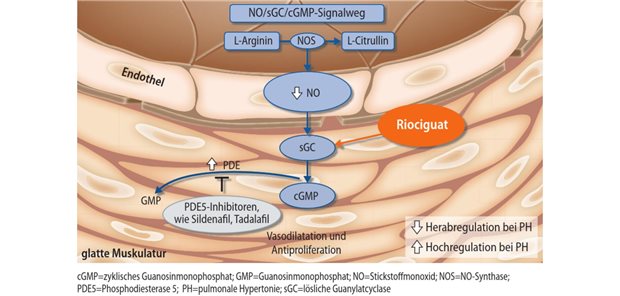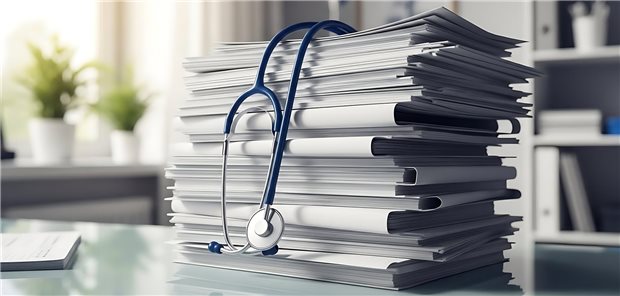Unterschiedliche Meinung
Welche Krankheit – Da sind Arzt und Patient oft uneins
Man sollte annehmen, dass sich Ärzte und Patienten über die therapierelevanten Diagnosen einig sind. Doch woran sie eigentlich erkrankt sind, darüber gehen die Ansichten oft auseinander. Eine Studie zeigt die häufigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen Arzt und Patient auf.
Veröffentlicht:
Meinungsstreit: Ärzte und Patienten sind bei Diagnosen oft unterschiedlicher Meinung – am wenigsten beim Thema Hypothyreose.
© ?????? ???????? / stock.adobe.com
Paris. Das Gelingen menschlicher Kommunikation betreffend, dürfte es kaum jemals einen größeren Skeptiker gegeben haben als Gorgias von Leontinoi. Der Philosoph, der im fünften Jahrhundert vor Christus lehrte, vertrat die Ansicht, es sei grundsätzlich nicht möglich, etwas zu erkennen. Und selbst wenn man etwas erkennen könnte, vermöchte man die Erkenntnis nicht mitzuteilen. Und könnte man sie mitteilen, so würde sie nicht verstanden.
An eine solche Weltsicht wird erinnert, wer eine jüngst publizierte Studie französischer Wissenschaftler um Dr. Stéphanie Sidorkiewicz von der Universität Paris Descartes liest. Die Untersuchung hat sich mit den chronischen Krankheiten beschäftigt, die Patienten zu haben glauben. Den Angaben der Patienten haben Sidorkiewicz und Kollegen die Diagnosen gegenübergestellt, die denselben Patienten von ihren Hausärzten gestellt worden waren (Ann Fam Med 2019; 17: 396–402).
Nur mäßige Übereinstimmung
An der Studie waren 233 Patienten beteiligt, die seit mindestens einem Jahr bei einem von 16 teilnehmenden Allgemeinärzten in Behandlung waren. Die Patienten gaben im Mittel 3,8, die Ärzte 3,4 chronische Erkrankungen an. Bei genauerer Betrachtung war die Übereinstimmung mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,59 aber nur mäßig; ein Wert von 1 gilt hier als ideal.
Um welche Krankheiten es sich im Einzelnen handelte, war noch deutlich strittiger. War man sich über die Diagnose Bluthochdruck noch einigermaßen einig (Korrelationskoeffizient 0,74), erreichte die Übereinstimmung bei den übrigen neun der zehn am häufigsten von Patienten geäußerten Diagnosen nur einmal einen Wert von 0,60 – nämlich bei der Frage, ob der Betreffende raucht oder nicht.
Für Asthma gab es mit einem Wert von 0,53 eine gerade noch mäßige Korrespondenz, die Werte für die übrigen chronischen Leiden rangierten allesamt auf sehr niedrigem Niveau. Für Angststörungen beispielsweise schlug ein Wert von 0,12 zu Buche.
„Therapeutische Allianz stärken!“
Relativ akzeptable Werte gab es für Hypothyreose (0,85), mäßig gute für Diabetes (0,70). Beide Diagnosen rangierten aber nicht unter den zehn am häufigsten genannten Krankheiten.
Vollends desaströs geriet die Aufgabe, eine Liste der drei wichtigsten chronischen Erkrankungen aufzustellen. Knapp 30 Prozent der von den Patienten an die erste Stelle gesetzten Diagnosen tauchten auf den Listen der behandelnden Hausärzte nicht auf. Und bei 12 Prozent der Patienten stimmte überhaupt keine der drei von ihnen genannten Erkrankungen mit irgendeiner auf der Ärzteliste überein. Sidorkiewicz und Mitarbeiter fordern daher, bestehende Versorgungsmodelle zu überdenken und die therapeutische Allianz zwischen Patienten und ihren Ärzten zu stärken.
Angesichts der Ergebnisse der aktuellen Studie hätte sich der Philosoph Gorgias vermutlich bestätigt gesehen. Dass er sich in seinem Leben allzu viel mit Listen seiner chronischen Krankheiten hätte beschäftigen müssen, ist ohnehin nicht anzunehmen: Gorgias wurde 108 Jahre alt.