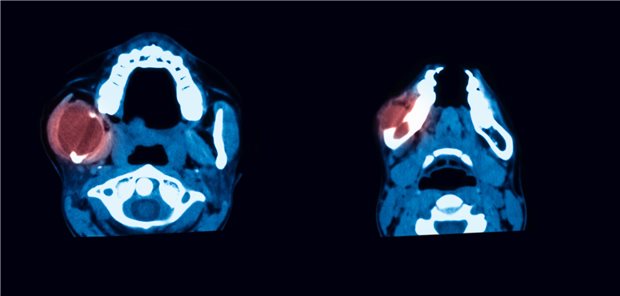Krebsforschung
Zusammenhang zwischen erhöhtem Blutzucker und Darmkrebs entdeckt
POTSDAM-REHBRÜCKE. Dass starkes Übergewicht ein Risikofaktor für das Kolonkarzinom ist, ist schon lange bekannt. Um mehr über die zugrundeliegenden Stoffwechselprozesse zu erfahren, haben Wissenschaftler des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung (DIfE) in einer großen europäischen Langzeitstudie Biomarker-Analysen durchgeführt (Am J Epidemiol (2017) 185 (9): 751-764). Diese weisen darauf hin, dass nicht nur eine kontinuierliche Gewichts- und Körperfettzunahme im Bauchraum eine Rolle für diese Beziehung spielen, sondern auch eine Störung des Zuckerstoffwechsels, teilt das DIfE mit.
Das Team um Heiner Boeing und Krasimira Aleksandrova vom DIfE untersuchte den Zusammenhang zwischen der Zunahme des Körpergewichts bei Erwachsenen, dem Darmkrebsrisiko und 20 Biomarkern mit Hilfe einer in der EPIC-Studie eingebetteten Fall-Kontroll-Studie. Diese schloss die Daten von 266 erstmals an Dickdarmkrebs und 186 an Enddarmkrebs erkrankten Menschen sowie die Daten von 452 nicht an Krebs erkrankten Kontrollpersonen ein.
Nach der Datenanalyse haben Erwachsene, die ab dem 20. Lebensjahr jährlich mehr als 300 Gramm Körpergewicht zulegen, im Vergleich zu Personen, die unter diesem Wert bleiben, ein um 54 Prozent erhöhtes Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken. Diese Risikoerhöhung beobachteten die Forscher auch, wenn Menschen mittleren Alters über einen Zeitraum von 30 Jahren mehr als 9 Kilogramm Gewicht zunahmen. Kontrollpersonen derselben Altersgruppe, deren Körpergewicht langfristig stabil war, hatten kein erhöhtes Darmkrebsrisiko.Die Forscher beobachteten, dass für die Risikobeziehung zwischen Gewichtszunahme und Dickdarmkrebs eine Zunahme des Taillenumfangs sowie ein hoher HbA1c-Wert von Bedeutung sind. Für Enddarmkrebs stellten sie in dieser Studie keine deutliche Risikoerhöhung fest. "Wir nehmen daher an, dass der beobachtete Zusammenhang zwischen Gewichtszunahme und Dickdarmkrebs mit physiologischen Veränderungen einhergeht, die zumindest teilweise auf eine Zunahme des Bauchfetts und eine Störung des Zuckerstoffwechsels zurückzuführen sind", wird Erstautorin Krasimira Aleksandrova vom DIfE zitiert. "Aus einer früheren Untersuchung wissen wir zudem, dass auch ein gestörter Fettstoffwechsel für die Dickdarmkrebs-Entstehung eine Rolle spielen könnte. Ob jedoch ein über lange Zeit erhöhter Blutzuckerspiegel das Dickdarmkrebsrisiko direkt negativ beeinflusst, wissen wir derzeit nicht. Zumindest liefert die neue Studie aber weitere Ansatzpunkte, die sich weiterverfolgen lassen, um die molekularen Mechanismen der Dickdarmkrebs-Entstehung aufzuklären", so Aleksandrova. Diese zu kennen, sei eine wichtige Voraussetzung, um neue Therapiestrategien zu entwickeln. (eb)