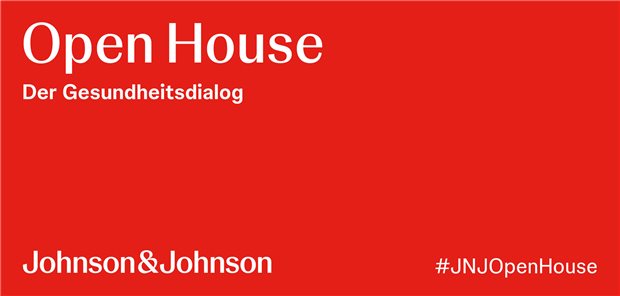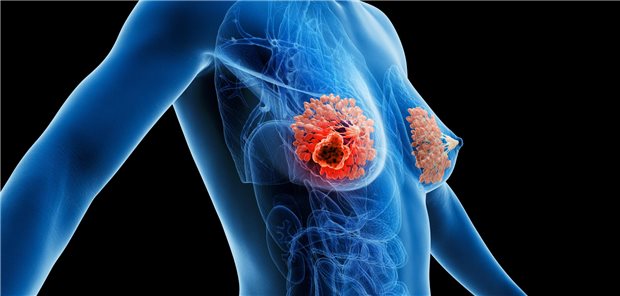MB-Vorsitzende im Interview
Johna: „Spahn hat mehr angestoßen als vorangebracht“
Der scheidende Gesundheitsminister habe Gutes angestoßen, aber vieles nicht zu Ende gedacht: Die MB-Vorsitzende Dr. Susanne Johna zieht im Interview eine durchwachsene Bilanz der Ära Spahn.
Veröffentlicht:
Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Dr. Susanne Johna, beim Interview.
© Michaela Illian
Ärzte Zeitung: Im Bund zeichnet sich eine Ampelkoalition ab. Frau Dr. Johna, werden Sie Jens Spahn als Gesundheitsminister vermissen?
Dr. Susanne Johna: Er hat sehr viel Gutes angestoßen und Tempo gemacht, was teilweise nötig war, zum Beispiel bei der Digitalisierung. Aber es war auch eine regelrechte Gesetzesflut, und oft waren die Dinge nicht ganz zu Ende überlegt. Das hat die Selbstverwaltung teils über Gebühr beansprucht. Die Gespräche mit ihm behalte ich als angenehm in Erinnerung, wenngleich sie in der Sache oft hart waren.
Wie fällt Ihre Bilanz seiner Politik aus?
Er hat mehr angestoßen als vorangebracht. Die dringend nötige Reform der Notfallversorgung hat er nicht zu Ende gebracht, sondern mit dem Ersteinschätzungsverfahren einen kleinen Baustein herausgegriffen, was keine gute Idee war.
Marburger Bund und KBV hatten schon 2017 einen Plan für die Notfallreform vorgelegt. Den könnten Sie jetzt wieder aus der Schublade holen.
Mir scheint, die KBV steht nicht mehr ganz so dazu.
Warum eigentlich?
Für uns ist gar nicht so wichtig, wer den Hut auf hat in der Notfallversorgung, sondern dass wir zu einer wirklichen Zusammenarbeit der Sektoren kommen und nicht zu einem dritten Sektor. Wir wollen nicht, dass Patienten aus dem Krankenhaus weggeschickt werden, nur weil sie ambulante Fälle sind. Idealerweise sollen sie bei der telefonischen Ersteinschätzung richtig gesteuert werden. Wer aber schon am oder im Krankenhaus ist, sollte dort auch abschließend ambulant versorgt werden. Sonst verschwenden wir wieder ärztliche Arbeitszeit, wenn der Patient mehrfach vorstellig werden muss. Idealerweise sind dann Vertragsärzte vor Ort, die ihn behandeln können.
Viele Patienten könnten schon heute ambulant versorgt werden, nur sind die meisten Ärzte stationär tätig.
Das ist ein großer Irrtum in der Diskussion: Ex post betrachtet stimmt das, aber in der Notfallversorgung wissen Sie das oft eben erst hinterher. Da gibt es viele Graubereiche. Hinter akuten Bauchschmerzen können auch schwere Blutungen stecken, das müssen Sie erst einmal ausschließen. Und wir wissen, dass die Vortestwahrscheinlichkeit etwa für einen Herzinfarkt bei Schmerzen im Brustkorb im Krankenhaus deutlich höher ist als beim Hausarzt.
In Berlin formiert sich gerade ein Ampelbündnis als mögliche neue Bundesregierung. Erste Ideen kennen wir aus dem Sondierungspapier. Was erwarten Sie von Rot-Gelb-Grün, eher Chancen oder Risiken?
Es gibt viele Chancen. Dass die Sondierer Prävention zum Leitprinzip der Gesundheitspolitik erklären, finde ich wirklich gut. Wenn sie Verhältnis- und Verhaltensprävention als breites Politikthema sehen, das über Gesundheit hinausgeht, zu dem auch Bildung gehört, sowie Ernährung, Umwelt, Verkehr und Städtebau, dann wäre ein wichtiger Rahmen geschaffen. Prävention ist ein auf sehr lange Zeit angelegtes Projekt, dazu muss Politik erstmal bereit sein.
Die letzte Regierung ist da nicht weit gekommen. Denken Sie nur an die Nationale Diabetes-Strategie, ein echter primärpräventiver Ansatz, die war nicht zum Fliegen gekommen.
Ja, das ist sehr bedauerlich. Wir haben eine Ewigkeit gebraucht, Tabakwerbung zu verbieten. Wollen wir wieder so lange brauchen, um zuckerhaltige Getränke zu besteuern? Zumindest Getränke mit fünf Gramm oder mehr Zucker pro 100 Milliliter müssen endlich empfindlich besteuert werden. Wir wissen, dass solche Maßnahmen etwas bringen. Das gilt für die Sekundär- wie Tertiärprävention. Gerade die Reha erfährt viel zu wenig Aufmerksamkeit, weil Pflege- und Krankenkassen nur wenig miteinander zu tun haben. Dabei würde jeder Euro für die Rehabilitation uns hinten raus viele Ausgaben sparen helfen. Teile der beruflichen Rehabilitation könnten hier als Vorbild gelten.
Sie sehen also vor allem Chancen?
Schon, aber manches ist noch zu kurz gegriffen. Die Kinderheilkunde und die Geburtshilfe sollen aus dem DRG-System herausgenommen werden. Ja, das sind völlig unterfinanzierte Bereiche, aber das geht nicht weit genug. Wir brauchen ein wirklich neues Finanzierungssystem in der Krankenhausversorgung. Wir müssen uns endlich von der Vorstellung verabschieden, eine sinnvoll strukturierte stationäre Versorgung dadurch zu schaffen, dass wir die Krankenhäuser einem Wettbewerb aussetzen. Das haben die Kliniken lange genug praktiziert und das Gegenteil ist passiert. Die Versorgung ist nicht besser geworden, sondern hat sich entlang der Kostenstrukturen organisiert und wichtige Bereiche immer mehr vernachlässigt.
Der MB propagiert die Einführung von Vorhaltepauschalen.
Ja, das muss die Basis der Finanzierung sein, und zwar in drei Versorgungsstufen: regionale, überregionale und Maximalversorgung, hinzu kommen die Unikliniken. Jedes Haus müsste bestimmte gestufte Voraussetzungen erfüllen. Die regionalen Kliniken müssen verpflichtend mit einem überregionalen, oder besser Maximalversorger vernetzt sein. In der Pandemie hat das ja funktioniert, dass die Häuser sich unterstützt haben und Patienten verlegt wurden. Es geht nicht um Konkurrenz, sondern darum, im Sinne der Patienten zu handeln. Das geht aber nur, wenn wir den Finanzierungsdruck von den Personalkosten nehmen.
Aber könnten so nicht bestehende Strukturen eher zementiert werden?
Das neue Finanzierungssystem muss parallel zu einer neuen Krankenhausplanung etabliert werden. Das eine geht nicht ohne das andere. Wir sehen ja die Probleme bei der Ausgliederung der Pflegepersonalkosten. Die war im Prinzip richtig, setzt aber auch Fehlanreize, wenn Pflegekräfte jetzt wieder Dinge tun sollen, die ihnen vorher andere Berufsgruppen abgenommen hatten, nur weil die Pflege jetzt voll gegenfinanziert wird.
Und wie lösen Sie das Investitionsproblem in den Ländern?
Die duale Krankenhausfinanzierung ist ja von der Grundidee richtig. Vor allem sollten sich die Länder daran erinnern, dass sie ohne Investitionen eine wichtige Steuerungsmöglichkeit aus der Hand geben. Die Krankenhausplanung ließe sich über Investitionen doch ideal lenken.
Sollte der Bund stärker eingreifen?
Das tut er schon mit dem Strukturfonds und dem Krankenhauszukunftsgesetz. Übrigens mit sehr detaillierten Vorgaben: Es wird gerne vergessen, dass Krankenhäuser ab 2025 Abschläge bekommen, wenn sie die verpflichtenden Fördertatbestände des KHZG nicht umsetzen.
Der Stufenplan des GBA für die Notfallversorgung ist auch ein retrograder Hebel zur Steuerung der Versorgung. Geht das denn in die richtige Richtung?
Die Kernfrage ist: Wie viel Versorgung brauchen wir und wo brauchen wir sie? Dafür müssen wir die demografische Entwicklung in den Regionen betrachten, auch die Bevölkerungsströme. Eine Region, die in 20 Jahren 20 Prozent weniger Einwohner hat, wird eine andere Versorgungsstruktur brauchen, aber sicher keine neue Uniklinik.
Wir sind also wieder an den Sektorengrenzen, die es eigentlich einzureißen gilt. Welcher Hammer ist der richtige dafür?
Ist der Hammer das richtige Werkzeug? Sie haben recht, wir reden seit Ewigkeiten über die Sektorengrenzen. Aber ich glaube, es verändert sich etwas allein durch die Ärztinnen und Ärzte, die gar nicht mehr in diesen absoluten Strukturen denken. Die Kolleginnen und Kollegen fragen sich, wie sie ihre Patienten am besten versorgen können. Da entsteht ganz automatisch die Bereitschaft, das gemeinsam zu tun. Das ist noch nicht genug, keine Frage. Deswegen müssen wir die Planung, ganz besonders im ländlichen Bereich völlig neu denken. Wenn dort auf einmal ein kleines Krankenhaus schließt, das bislang Röntgen oder Labor vorgehalten hat, haben auch die dortigen Niedergelassenen ein Problem.
Schließen Sie sich den Befunden mancher Beobachter an, dass wir am Ende weniger Klinikstandorte brauchen?
Ich glaube schon, dass sich die Zahl der Krankenhäuser weiter verringern wird. Das ist aber, wie gesagt, kein Selbstzweck, sondern hängt vom Versorgungsbedarf und den zur Verfügung stehenden Versorgungsstrukturen ab. Wenn wir in einer Region ambulante fachärztliche Kompetenz nur dadurch sichern können, dass wir eine stationäre Einrichtung haben, müssen wir dafür ein gutes Modell finden.
Manche Krankenhausgesellschaften würden gerne vollständig in die ambulante Versorgung einsteigen.
Nein, soweit würde ich nicht gehen. Das ist auch nicht im Sinne der Krankenhausärzte, die auch so genug zu tun haben. Sinnvoll wäre eher, wenn Krankenhäuser sich an der ambulanten Weiterbehandlung beteiligen könnten, etwa über MVZ. Dann kennen sie die Krankengeschichte und haben alle Informationen direkt verfügbar. Die E-Patientenakte kommt ja nicht so richtig voran.
Aber dann kommen wir nicht um eine integrierte Bedarfsplanung herum, die ambulante und stationäre Versorgung gemeinsam plant, oder?
Im ländlichen Bereich fände ich das gut, im städtischen Bereich halte ich das nicht für nötig.
Und am Ende geht der Sicherstellungsauftrag an die Länder oder Kommunen über?
Der Wunsch der Kommunen, möglichst alles vor Ort anzubieten, ist ja aus deren Sicht verständlich. Aber die Strukturen sind nicht immer notwendig für die Patienten. Deswegen ist eine zu kleinteilige Planung auch nicht sinnvoll. Wir müssen in größeren Konzepten denken und dürfen dabei auch nicht an den Ländergrenzen halt machen. Auch das wird heute in den Landeskrankenhausplänen zu oft nicht berücksichtigt. In der Regel wird es den Patienten ja egal sein, ob sie nun in Wiesbaden oder Mainz stationär behandelt werden, solange sie gut behandelt werden.
Spricht da die Freundin regionaler Versorgungskonzepte?
Regionale Vernetzung ist unabdingbar für eine gute Gesundheitsversorgung. Das Gesunde Kinzigtal ist ein gutes und sinnvolles Projekt. Die Patienten haben sich, nach dem, was man hört, dort gut aufgehoben gefühlt. Dass die Patienten von Zusammenarbeit profitieren, liegt doch auf der Hand. Wir müssen uns endlich von der Vorstellung des Verdrängungswettbewerbs verabschieden. Insofern sind solche Projekte zur Nachahmung empfohlen.
Die Reform der Notfallversorgung sollte die Zusammenarbeit ja fördern. Dann ist der Marburger Bund aber aus dem SmED-Beirat ausgetreten. Ist das Tischtuch zwischen Ihnen und der KBV zerschnitten?
Nein. Wir haben nur bei einem konkreten Projekt einen Dissens mit dem Zentralinstitut der KBV. Wir hatten uns gewünscht, dass das System aus den Problemen der Anwender lernt und wissenschaftlich validiert wird. So ist es aber nicht. Wir haben auch Probleme damit, dass der Algorithmus nicht offengelegt wird. Wie sollen wir dann prüfen, ob die Ersteinschätzung medizinisch korrekt funktioniert? Und wir wollen kein System, das dort zum Einsatz kommt, wo Ärzte die Entscheidung besser selbst treffen können, nämlich vor Ort im Krankenhaus.
Und wie kommen Sie wieder mit dem Zi zusammen?
Wir müssen auf jeden Fall nachjustieren, dann können wir es gemeinsam schaffen und es wäre der Einstieg in eine gemeinsame Notfallversorgung mit den Vertragsärzten.
Womit das Problem noch nicht gelöst ist, wo die Vertragsärzte für die gemeinsamen Tresen herkommen sollen.
Uns ist schon klar, dass das nicht rund um die Uhr geht und die Kollegen am nächsten Tag wieder in ihre Praxis müssen. Deswegen müssen wir überlegen, in welchen Versorgungsstufen und zu welchen Zeiten die Bereitschaftsdienstpraxen am Krankenhaus geöffnet sein müssen. Aber prinzipiell sollten wir vor Ort zusammenarbeiten und die Niedergelassenen und Krankenhäuser vernetzen.
In Hessen gibt es ja das SaN-Projekt, das mit Partnerpraxen arbeitet, die über IVENA ihre Verfügbarkeiten für die Kliniken und den Rettungsdienst melden. Wäre das nicht ein bundesweites Modell?
Absolut. Es wird aber spannend sein zu sehen, wie es vor Ort läuft, wie häufig Patienten dann doch von A nach B und von B nach A geschickt werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die meisten Vertragsärzte Terminpraxen haben. Wenn ein Notfall kommt, müssen alle länger warten. Oder Sie organisieren in der Praxis feste Zeiten für Notfallpatienten und dann kommt niemand. Die Scheinzahlen sind nicht planbar. Das sind echte Herausforderungen für die Praxisabläufe. Und ich komme wieder zur Digitalisierung: Wenn der Patient dann doch ins Krankenhaus muss, sollten dort auch die Daten aus der Praxis vorliegen, damit die gleichen Fragen nicht zweimal gestellt werden müssen. Durch einen besseren digitalen Austausch könnten wir viele Dinge verbessern.
Reden wir übers ärztliche Dasein, Frau Johna. Wie erleben Sie eigentlich selbst den Krankenhausalltag?
Als Oberärztin habe ich es sicher um manches leichter als junge Kollegen.
Ihr Vorteil! Aber ob jung oder erfahren, es wird im Alltag ja ganz basale Probleme geben.
Natürlich! Die Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung treibt uns alle sehr um. Sie sorgt dafür, dass wir immer mehr unserer Zeit fürs Rechtfertigen und für Bürokratie verbrauchen. Das ist total frustrierend und nicht das, wofür wir unseren Beruf ausüben wollen. Wenn wir das abstellen könnten, würden wir sofort eine Menge Arbeitszeit bei Ärzten und Pflegekräften gewinnen.
Diesen Frust schildern uns bereits Studenten aus dem klinischen Abschnitt und PJ. Erleben Sie das auch?
Das erleben wir auch, dafür benutze ich gerne den Begriff Kulturschock. Die Absolventen kommen mit sehr viel Enthusiasmus von der Universität und erleben plötzlich einen Arbeitsalltag, in dem es nur zu einem Viertel um die Versorgung von Patienten geht. Auch aus diesem Grund, nicht nur wegen Familie oder Work-Life-Balance, entscheiden sich immer mehr Klinikärzte für Teilzeit. Das ist eine private Arbeitszeitreform.
Auch in der Weiterbildung knirscht es, wie erst jüngst Ihr MB-Barometer gezeigt hat.
Wenn Weiterbildung als reines Abfallprodukt der klinischen Tätigkeit gesehen wird, keine Zeit dafür reserviert wird und sie in den Klinikerlösen nicht eingepreist ist, ist das ein Problem. Jedes größere Unternehmen hat ein Personalentwicklungskonzept. Aber in vielen Krankenhäusern ist das ein Fremdwort. Da ist ein Umdenken bei der kaufmännischen Leitung nötig, die gut weitergebildete Ärzte als Investition in den eigenen Standort verstehen sollte.
Der MB ist die Vertretung der angestellten Ärzte. Und der Trend zeigt eindeutig nach oben, auch im ambulanten Bereich. Ein Grund zum Jubeln für Sie?
Ja, das ist durchaus positiv, weil es den Kolleginnen und Kollegen mehr Wahlfreiheit gibt, wie sie arbeiten möchten. Auch dadurch entsteht eine Vermischung von ambulant und stationär und das gegenseitige Verständnis wächst. Der Trend zur Anstellung ist genauso ein Fakt wie die abnehmende Attraktivität der inhabergeführten Einzelpraxis. Die jungen Kolleginnen und Kollegen wollen überwiegend im Team arbeiten, in größeren kooperativen Strukturen.
Der KBV-Vorstand hat den Trend jüngst bei uns als Gefahr für den Sicherstellungsauftrag bezeichnet. Dem stimmen Sie nicht zu?
Die Einschätzung teile ich nicht. Es mag sein, dass die ärztliche Arbeitszeit sinkt, aber das tut sie überall. Am Ende kommt es auf die Gesamtzahl der Ärzte in der Versorgung an. Und angestellte Ärzte sind wie Praxisinhaber auchan die Vorgaben des SGB V gebunden, wirtschaftlich, ausreichend, notwendig und zweckmäßig zu handeln. Ich glaube im Gegenteil, dass Angestellte die vertragsärztliche Versorgung bereichern. Und ja, wir verstehen uns als ihre Gewerkschaft und werden uns für ihre Interessen stark machen.
Frau Johna, zu guter Letzt, müssen wir über den 125. Deutschen Ärztetag sprechen, auf dem der Klimawandel als Leitthema behandelt werden soll. Warum beschäftigen sich eigentlich die Ärzte damit, weil es vielleicht en vogue ist?
Das wäre ja schön, wenn es einfach en vogue wäre. Aber das Thema Klimawandel brennt uns allen unter den Nägeln. Erstens steht in unserer Berufsordnung, dass wir an der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Gesundheit mitwirken sollen. Es gehört also zu unserem ärztlichen Beruf, uns um dieses Thema zu kümmern. Zweitens werden wir in Zukunft mehr mit klimabedingten Erkrankungen konfrontiert sein, z.B. mit zoonotischen Erkrankungen, die wir in Deutschland bislang nicht gesehen haben. Das müssen wir in der Weiterbildung berücksichtigen. Auch müssen wir als Vertrauenspersonen unsere Patienten auf die Probleme des Klimawandels hinweisen. Und wir müssen im Gesundheitswesen selbst den CO2-Fußabdruck reduzieren, etwa bei der Klimatisierung der Einrichtungen, der Abfallwirtschaft, den Verbrauchsmaterialien …
… und bei Arzneimitteln?
Oh ja! Wenn wir den gesamten CO2-Fußabdruck bei der heutigen Medikamentenproduktion einpreisen würden, würden wir nicht mehr in Asien produzieren, weil es sich nicht mehr rechnen würde. Dann würden wir Kapazitäten in Europa aufbauen, was für die Versorgungssicherheit sehr sinnvoll wäre.
Braucht es einen Facharzt für Klimawandel?
Nein.
Beim Ärztetag wird auch eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger der verstorbenen Heidrun Gitter im BÄK-Präsidium gewählt. Was erwarten Sie von ihm oder ihr?
Ich erwarte natürlich, dass im Präsidium auch die Interessen der angestellten Kolleginnen und Kollegen mitbedacht werden. Heidrun Gitter fehlt uns menschlich und mit ihrer enormen berufspolitischen Erfahrung. Deswegen finde ich die Kandidatur von Günter Matheis sehr gut, weil er alle Voraussetzungen mitbringt und über sehr viel Erfahrung verfügt.
Vielen Dank für das Gespräch.
Dr. Susanne Johna
- Vorsitzende des Marburger Bundes seit 2019
- Oberärztin für Krankenhaushygiene im St. Josefs-Hospital in Rüdesheim
- Intensivstudium der Gesundheitsökonomie an der European Business School
- Vorstandsmitglied der Bundesärztekammer seit 2016
- Privates: Susanne Johna ist verheiratet und Mutter zweier erwachsener Kinder