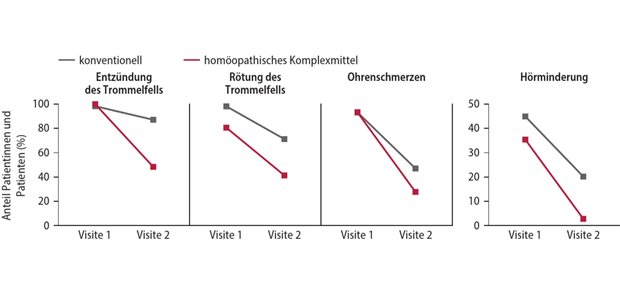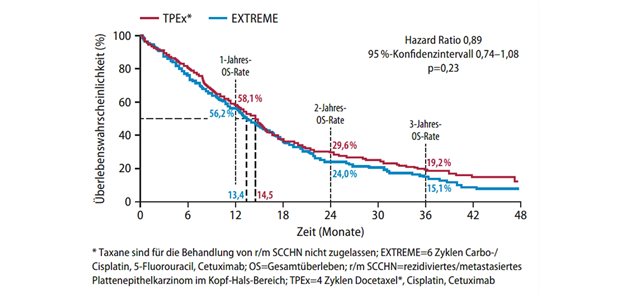Cochlea-Implantat
Eltern gegen Operation des gehörlosen Kindes
Ein Rechtsstreit, der für Aufsehen sorgt: Das Familiengericht in Goslar verhandelt die Klage des Klinikums Braunschweig gegen die Eltern eines gehörlosen Kindes. Diese wehren sich gegen die empfohlene OP.
Veröffentlicht:
Die Welt der Hörenden: Ein zehnjähriger Junge, der Cochlea-Implantate trägt, spielt auf einem Klavier.
© Jochen Lübke/dpa
GOSLAR. Darf ein Krankenhaus ein Cochlea-Implantat für ein Kind erzwingen? Das Goslarer Familiengericht verhandelt derzeit die Klage des Klinikums Braunschweig gegen die Eltern eines gehörlosen eineinhalbjährigen Jungen. Die Eltern wollen ihm nicht das ärztlich empfohlene Cochlea-Implantat (CI) einsetzen lassen. Das Kindeswohl werde vernachlässigt, wenn die Eltern sich nicht für ein Implantat entscheiden, lautet die Begründung des Krankenhauses.
Weder der Rechtsanwalt der Eltern, Alexander Lawin, noch das Familiengericht, noch das Klinikum wollten sich auf Anfrage der "Ärzte Zeitung" zu dem Verfahren äußern. Aber so viel ist klar: Aus Sicht der Eltern ist ihr Kind weder behindert noch krank. Daher könne mit dem Verzicht auf ein CI auch nicht von vernachlässigtem Kindeswohl die Rede sein. Das Krankenhaus greife deshalb mit seinem Schritt in das verfassungsmäßige Elternrecht ein, aus eigener Erwägung das Richtige zu tun, erklärt Lawin in einem Fernsehbericht des Bayerischen Rundfunks.
"Kindern Möglichkeiten öffnen"
Das Verfahren hat auch eine ethische Seite. Für den Medizinethiker Professor Urban Wiesing von der Universität Tübingen zählt bei gehörlosen Kindern, die ein CI tragen, auch der Umstand, dass sie damit größere Möglichkeiten erhalten als nicht operierte. "Eltern sollten ihren Kindern Möglichkeiten eröffnen, und nicht verschließen", sagt Wiesing der "Ärzte Zeitung". Deshalb plädiert er im vorliegenden Fall eher für ein Cochlea-Implantat, weil es dem Kind ermöglicht, an der Welt der Hörenden teilzunehmen. Allerdings rührt der Konflikt an grundsätzlichere Aspekte, meint Wiesing. "Medizinethisch gesehen stellt sich hier die Frage, was pathologisch und was Vielfalt ist", erklärt der Ethiker. In vielen Bereichen habe sich die Gesellschaft entschieden, quasi neue Schubladen zu öffnen und einst Abweichendes als eigene Lebensform zu akzeptieren.
So verstehen Menschen mit Down-Syndrom ihr Leben als ihre eigene Form der Gesundheit. Und erst kürzlich hat das Bundesverfassungsgericht einer intersexuellen Klägerin das Recht zugesprochen, sich mit einem dritten Geschlecht in das Personenstandsregister eintragen zu lassen. "Wir akzeptieren das inzwischen", sagt Wiesing.
Gehörlosen-Bund ist skeptisch
Der Deutsche Gehörlosen-Bund bezweifelt diese Akzeptanz. Das ausschließliche Sich-Verlassen auf besseres Hören durch ein Implantat störe die bilinguale Sprachentwicklung und lasse die positiven Aspekte des Lebens Gehörloser außer Acht, heißt es in der Erklärung des Bundes zum Fall in Goslar. Für eine bilinguale Sprachentwicklung sind aus Sicht des Bundes die Schriftsprache plus Gebärdensprache und im Zweifel ein Hörgerät die Mittel der Wahl. Denn "die meisten im Rahmen der Implantationen Tätigen haben keine oder nur sehr wenige Informationen über die Gehörlosen-/Gebärdensprachgemeinschaft und kaum Erfahrungen mit diesen. Diese sehen in der Gehörlosigkeit nicht selten etwas Negatives und Auszumerzendes", kritisiert der Verband. Der Prozessauftakt war im November 2017. Zum weiteren Verfahrensverlauf macht das Gericht keine Angaben.
Nach Angaben der European Association of Cochlear Implant Users (EURO-CIU) sind bisher europaweit über 150.000 hörgeschädigte Menschen mit einem CI versorgt, 40 Prozent von ihnen sind Kinder. In Deutschland leben derzeit rund 40.000 CI-Träger. Jährlich kommen rund 3000 hinzu.