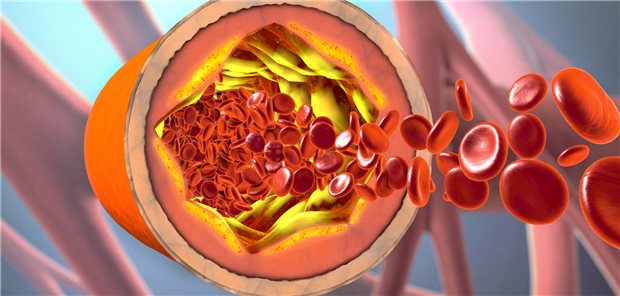Psychiatrische Versorgung
Psychiatrische Kliniken machen gute Erfahrungen mit Regionalbudgets
Mit der Vereinbarung eines von der Patientenzahl abhängigen Regionalbudgets können psychiatrische Einrichtungen ihr Behandlungsangebot flexibler gestalten. Mit durchweg positiven Auswirkungen auf die Behandlungskontinuität in der ersten Welle der COVID-19-Pandemie.
Veröffentlicht:
Mit Regionalbudgets lässt sich flexibler planen, sagen Ärzte, die bereits mit ihnen arbeiten.
© ronstik / stock.adobe.com
Berlin. Eine durchweg positive Bilanz ihrer Erfahrungen mit dem Regionalbudget haben Vertreter psychiatrischer Einrichtungen beim jüngsten Digital-Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Ende November in Berlin gezogen. Das Budget berücksichtigt die Entgelte für alle Behandlungsformen – stationär, in der psychiatrischen Institutsambulanz, in der Tagesklinik sowie in der ambulanten Versorgung. Dabei kann die konkrete Behandlungsform und ihr Setting frei gewählt werden.
Die Höhe des Budgets ist abhängig von der Zahl der Patienten, für die prospektiv ein Korridor vereinbart wird.
Home-Treatment ausgebaut
Erfahrungen mit dem Budget hat die Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik Heidenheim seit 2017: Deren Chefarzt Dr. Martin Zinkler berichtet von einer steigenden Zahl der Behandlungen in der Institutsambulanz – von 400 auf 450 bis 2019 – und einer Flexibilisierung des Angebots durch aufsuchende Arbeit der Ambulanzen in Pflegeheimen und Teams zur Vor-Ort-Therapie. Übergänge von der stationären zur ambulanten Behandlung könnten besser organisiert werden, Patientenpräferenzen könnten eher berücksichtigt werden.
Als robust habe sich die Versorgung aufgrund des vereinbarten Budgets auch während der Lockdownphase in der ersten Pandemiewelle erwiesen, so Zinkler. Die stationäre Belegung sei heruntergefahren worden, um jedem Patienten ein Einzelzimmer zu sichern, in der Tagesbehandlung sei auf einen Zwei-Schicht-Betrieb gewechselt worden. Bei einer Kapazitätsauslastung von 94 Prozent habe es keine Wartezeiten gegeben. Erheblich ausgebaut worden sei das Home-Treatment: von 1017 Patienten im ersten Quartal auf 1401 Patienten im dritten Quartal. Zinkler: „Im Ergebnis ein lernfähiges und flexibles Versorgungssystem, das finanziell stabil ist.“
Ähnliche Erfahrungen macht derzeit auch das Pfalzklinikum, das mehrere Einrichtungen im südlichen Rheinland-Pfalz betreibt. Hier gilt das Regionalbudget seit dem 1. Januar 2020. Als einen wesentlichen Vorteil sieht Chefarzt Dr. Andres Fernandez die Reduzierung der MDK-Prüfungen. Im Prinzip bestätigt er die Erfahrungen seines Heidenheimer Kollegen: die bessere Berücksichtigung von Patientenpräferenzen, die optimierte Vernetzung mit der ambulanten Versorgung, die Option aufsuchender Behandlung.
Das Krisenmanagement habe verbessert werden können, ferner sei eine Reduktion von Zwangsmaßnahmen möglich. Auch der Einsatz von Telemedizin könne praktiziert werden. Wesentlich sei, dass dem Patienten während des gesamten Behandlungsprozesses in verschiedenen Settings mit Fachkräften aus verschiedenen Disziplinen eine Bezugsperson zur Verfügung steht.
Einsatz der Mitarbeiter ändert sich
Als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie habe man eine Quotierung der Patientenzahlen zur Infektionsvermeidung einführen müssen. Die aufsuchende Arbeit sei eingeschränkt worden, der Aufwand aufgrund von Hygienevorkehrungen sei beträchtlich gestiegen.
Per Saldo seien positive Effekte sichtbar geworden: durch den Aufbau telemedizinischer Angebote, die räumliche Flexibilisierung, die Weiterentwicklung niedrigschwelliger und wohnortnaher Therapiemöglichkeiten. Das habe aber auch Konsequenzen für die Mitarbeiter, deren Tätigkeit sich von der stationären zur teilstationären und ambulanten Arbeit verlagert. Auf der Basis von Routinedaten werde das Projekt evaluiert. Zusätzlich sind Befragungen von Patienten, deren Angehörigen und den kooperierenden ambulanten Akteuren sowie eine Mitarbeiterbefragung geplant, mit der die Arbeitssituation erhoben werden soll.